AKUT

Archiv 2002 – Projekt Ikarus
Der Sprung von der Jesus-Statue in Rio machte ihn berühmt. Jetzt will Base-Jumper Felix Baumgartner beim antriebslosen Sprung über den Ärmelkonal endgültig beweisen, dass ihm sein Sponsor Flügel verleiht.
Text: Thomas Bischof
Er redet schnell, und seine Augen leuchten. Wie immer, wenn er von seinen Projekten spricht. Felix Baumgartner hat nichts weniger als einen Menschheitstraum im Visier: Projekt Ikarus, den vom antriebslosen Flug. Dafür war er einen Monat bei -35° in der Arktis, dafür läuft seit dem vergangenen Jahr eine penible Vorbereitung, und wenn’s sein muss, wartet er dafür wochenlang auf den perfekten Tag. Und der sollte diesen Sommer kommen. Doch aerodynamische Probleme hatten den 33-jährigen Extremisten auf Warteschleife geschickt. Die Zeit verkürzte er sich mit einem Sprung vom „Agios Staphanos“, den Meteora-Klöstern im Lande Ikarus‘.

Felix Baumgartner und sein Fallschirm – eine bewährte Einheit, die die Grenzen seines Jobs abgesteckt hat. Der Base-Jumper hält sowohl den Weltrekord für den Sprung vom höchsten als auch vom niedrigsten jemals mit einem Fallschirm verlassenen Objekt. So weit so gut. Für sein aktuelles Projekt kommt zu diesen bewährten und adrenalingetränkten Zutaten des Abenteuers eine dritte dazu: ein Flügel mit 1,60 Meter Spannweite. Aber um in Stresssituationen ausgeschiedene Nebennierenprodukte geht es hier gar nicht so sehr. Es geht, erklärt der Salzburger, „um Herausforderungen und deren Meisterung.“
Felix hatte zwei Kindheitsträume: Fallschirmspringen und einen Porsche fahren. Beide hat er sich bereits erfüllt. Das eine wurde zum Beruf, das andere zum Freizeitritual. Jetzt kommt die Zeit für neue Träume. Und die bestehen aus B wie „Buildings“ (Gebäude), A wie „Antennas“ (Fernsehtürme), S wie „Spans“ (Brücken) und E wie „Earth“ (Berge). Womit wir bei der Basis zu B.A.S.E. angekommen sind. Und das bedeutet, sich von Gebäuden, TV-Türmen, Brücken und Bergen herunterzustürzen. Fünf Monate tüftelte der Träumer an James-Bond-artigen Spielzeugen und deren gewiftem Einsatz, fünf Wochen wartete er auf die perfekten Wind- und Wetterverhältnisse, um sich dann zweieinhalb Sekunden freien Fall von der Jesus-Statue in Rio de Janeiro zu genehmigen. „Diesen Sprung, das sage ich offen, würde ich nicht wiederholen“, gab Baumgartner hinterher zu. „Die Figur hat damals einfach eine irrsinnig starke Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Von 29 Metern geht normalerweise kein Sprung.“ Da musste er schon ein bisschen in die Trickkiste greifen. „Wir haben sekundengenau berechnet, wie lang der Schirm braucht, bis er vollständig aufgeht, usw. Trotzdem brauchst du das Quentchen Glück, damit dein perfekter Plan auch wirklich funktioniert.“
In der Nacht vor dem Sprung lässt sich Baumgartner im Security-bewachten Areal einsperren und schläft einige Stunden in den Bäumen. Um 4:00 morgens nimmt er die Statue mit seiner Armbrust in Angriff. Um diese überhaupt ins Land einführen zu können, gibt er sich beim brasilianischen Zoll als Sportschütze auf dem Weg zu einem Turnier aus. Sicherheitsleute auszutricksen ist der amüsante Teil des Spiels. Zwei seiner Mitspieler, sein Lehrer und Mentor sowie sein Kameramann, werden kurzfristig verhaftet. Baumgartner lässt sich mit einem der Security-Männer fotografieren.

Um die heilige Statue nicht zu entweihen, nimmt er auf den „Cristo Redentor“ sogar eine Harnflasche mit. Dann genießt er die beste Aussicht auf Rio: „Als ich auf dieser Hand stand, die ganz draußen nicht breiter als 20 Zentimeter ist, und in die aufgehende Sonne geschaut hab, hab ich gewusst: So ein Gefühl werde ich nie wieder erleben. Auf der einen Seite ist klar, wenn irgendetwas schief geht, seh ich nach diesen zweieinhalb Sekunden Flugzeit meine Eltern und alles, was mir im Leben so wichtig ist, nie wieder. Auf der anderen Seite hatten die Aura der Statue und die Momente auf der Hand fast eine spirituelle Dimension. Und dann dieser Sprung nach fünf Monaten Vorbereitung.“ Hauchdünn an der Plattform vorbei segelt er den Corcovado, den Hausberg der Stadt, hinunter zu einem Parkplatz, wo ein Fluchtauto auf ihn wartet.
Ein adrenalinsüchtiger Vollirrer, sagen Sie? Baumgartner, angewidert vom ewigen Klischee, kontert mit Reinhold Messner. Beim Bergsport zählt nur der, der von den schwierigsten und höchsten Bergen auch wieder runterkommt. Das gilt auch in meinem Sport. Ich bringe zwar mein Leben ständig in Gefahr, aber ich kann sie auch abschätzen.“
Angst ist die eine, Image eine andere Sache. Seriöse Berichterstattung ist ihm spätestens nach einer Geschichte des „Stern“ ein Grundbedürfnis. Das Selbstmörder-Image der Base-Jumper und ein mitgehörtes Telefongespräch waren einer Kollegin vom „Stern“ Grund genug, den 911er-Fahrer, der – auch wenn sein Aquaplaning-Unfall vor kurzem anderes vermuten lässt – den Bleifuß nur am Salzburgring rauslässt, als nächtlichen Autorennfahrer zu porträtieren. Hier die Richtigstellung: „Die Leute, die das gelesen haben, denken: Gratuliere zu Ihren Leistungen, Herr Baumgartner, aber nächtens Autorennen zu fahren ist asozial und unnötig. Das schaut aus, als wäre ich ein dummer 18-Jähriger, der mit seinem Golf GTI herumpresst. Wir Extremsportler sind Menschen, die wissen, wann sie welches Risiko eingehen, die sich professionell auf ihre Projekte vorbereiten. Natürlich kann etwas schief gehen, aber das kann es überall anders auch.“
Baumgartner war sein Sportlerleben lang Einzelkämpfer. Sein Berufsleben, das als Kfz-Mechaniker begann, schien dort auch schon zu enden: „In dem Job bist du ständig dreckig. Aber ich hatte zu wenig Selbstvertrauen, um da rauszukommen.“ Das findet er im Sport. Mit 17 beginnt er mit dem Fallschirmspringen. Es folgen Kampfsporterfahrungen als Judoka, professioneller Boxer; später wird er Motocrosser. In der HSNS Wiener Neustadt, in Diensten des Bundesheers, sieht er die optimale Möglichkeit, seinen Sport weiter zu betreiben. Was seine körperlichen und psychischen Fähigkeiten betrifft, dürfte es ihm nie an Selbstvertrauen gemangelt haben: „Meinen ersten professionellen Boxkampf hab ich gegen einen Kroaten gehabt, der in 140 Profikämpfen noch nie K.o. gegangen ist. Vor diesem Kampf hab ich mir gedacht: Was kann passieren? Und ich hab ihn in der ersten Runde K.o. geschlagen.“
Seine Bundesheer-Zeit hat seine Arbeitsweise, seine generalstabsmäßige Art der Planung und Durchführung, vielleicht sogar seine Lebensorganisation nachhaltig beeinflusst. Seine Berufsmaxime – „Bevor ich einen Sprung mache, versuche ich jede Kleinigkeit, die passieren kann, schon im Voraus zu erkennen und eine Lösung dafür parat zu haben“ – scheint verinnerlicht.
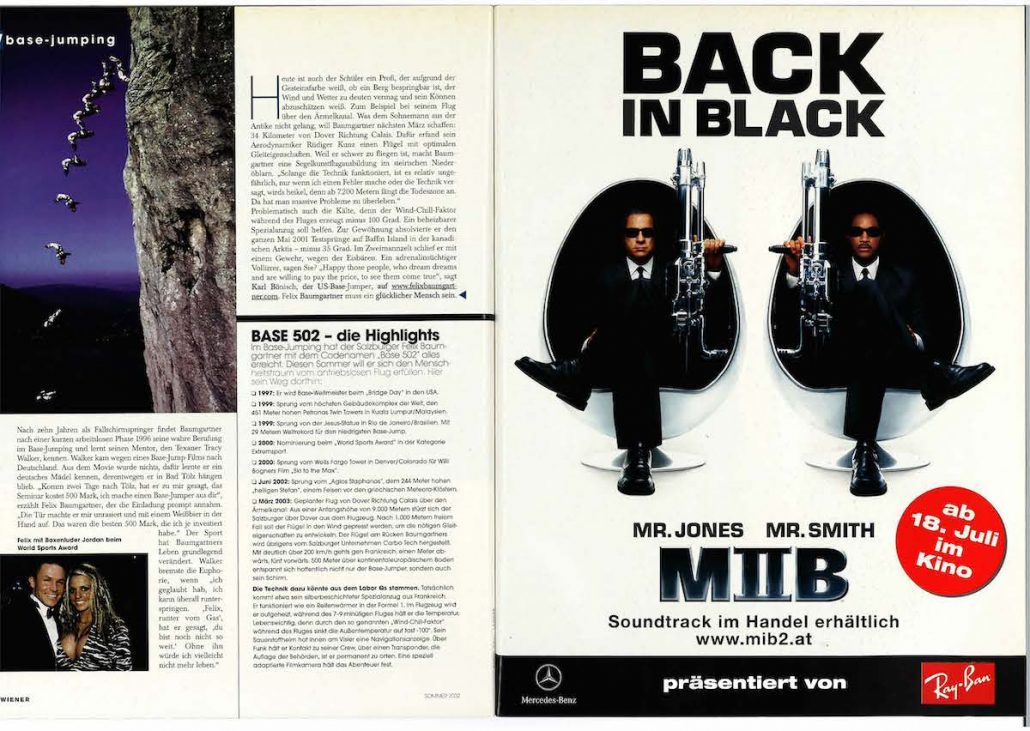
Nach zehn Jahren als Fallschirmspringer findet Baumgartner nach einer kurzen arbeitslosen Phase 1996 seine wahre Berufung im Base-Jumping und lernt seinen Mentor, den Texaner Tracy Walker, kennen. Walker kam wegen eines Base-Jump-Films nach Deutschland. Aus dem Movie wurde nichts, dafür lernte er ein deutsches Mädel kennen, derentwegen er in Bad Tölz hängen blieb. „Komm zwei Tage nach Tölz“, hat er zu mir gesagt, „das Seminar kostet 500 Mark, ich mache einen Base-Jumper aus dir“, erzählt Felix Baumgartner, der die Einladung prompt annahm. „Die Tür machte er mir unrasiert und mit einem Weißbier in der Hand auf. Das waren die besten 500 Mark, die ich je investiert habe.“ Der Sport hat Baumgartners Leben grundlegend verändert. Walker bremste die Euphorie, wenn „ich geglaubt hab, ich kann überall runterspringen. ‚Felix, runter vom Gas‘, hat er gesagt, ‚du bist noch nicht so weit.‘ Ohne ihn würde ich vielleicht nicht mehr leben.“
Heute ist auch der Schüler ein Profi, der aufgrund der Gesteinsfarbe weiß, ob ein Berg bespringbar ist, der Wind und Wetter zu deuten vermag und sein Können abzuschätzen weiß. Zum Beispiel bei seinem Flug über den Ärmelkanal. Was dem Sohnemann aus der Antike nicht gelang, will Baumgartner nächsten März schaffen: 34 Kilometer von Dover Richtung Calais. Dafür erfand sein Aerodynamiker Rüdiger Kunz einen Flügel mit optimalen Gleiteigenschaften. Weil er schwer zu fliegen ist, macht Baumgartner eine Segelkunstflugausbildung im steirischen Niederöblarn. „Solange die Technik funktioniert, ist es relativ ungefährlich, nur wenn ich einen Fehler mache oder die Technik versagt, wird’s heikel, denn ab 7.200 Metern fängt die Todeszone an. Da hat man massive Probleme zu überleben.“
Problematisch auch die Kälte, denn der Wind-Chill-Faktor während des Fluges erzeugt minus 100 Grad. Ein beheizbarer Spezialanzug soll helfen. Zur Gewöhnung absolvierte er den ganzen Mai 2001 Testsprünge auf Baffin Island in der kanadischen Arktis – minus 35 Grad. Im Zweimannzelt schlief er mit einem Gewehr, wegen der Eisbären. Ein adrenalinsüchtiger Vollirrer, sagen Sie? „Happy those people, who dream dreams and are willing to pay the price, to see them come true“, sagt Karl Bönisch, der US-Base-Jumper, auf www.felixbaumgartner.com. Felix Baumgartner muss ein glücklicher Mensch sein. ◄






