Archiv

HERREINSPAZIERT! Pathologie einiger Wiener Lokalitäten
Aus dem WIENER Archiv/Nummer 06/Juni 1980 – Wiener Lokalitäten
Text: HEIDI PATAKI
Kaschemmen, Beisln, Keller, Cafés…
Sie sind die wahren Nachfolger der Kirchen. Tag für Tag versammeln sich dann eine fluchende Gemeinde, die vor einer imaginären Obrigkeit zu Kreuze kriecht. Auf dem Lande, im Dorf ist der Zusammenhalt von Wirts- & Gotteshaus noch ganz offenbar. In den modernen Katakomben der Großstädte vollzieht sich genauso die merkwürdige Wandlung: Wasser wird zu Wein, und Wein oft zu Blut. Was dabei unwandelbar bestehen bleibt, ist der Männerbund, ein schulterklopfender, schenkelklatschender, ellbogenrempelnder Götzendienst reinsten Wassers!
Und mischt nicht im Geiste ein feister Herr Ober mit, der seinen Lappen über die Bänke klatscht und lässig die Reserviert-Täfelchen zurechtrückt?

Lokale sind der Kitt der Cliquen. Wo, wie in Wien, ein freimütiges, gesellschaftliches Leben fehlt, müssen sie als Ersatz dafür herhalten. Ein Irrtum wäre es, zu glauben, die paar Lokale, die gerade en vogue sind, dienten dem Amüsement. Ein „In“-Lokal hat nur in entfernter Weise was mit Essen & Trinken zu tun. Es besitzt eine vorwiegend gesellschaftliche Funktion: es spiegelt den Markt. Heute werden ja bekanntlich nicht nur Ideen, Gegenstände oder Objekte der Kunst verhökert – auch Leute sind Waren. Als Gäste notieren sie an einer unsichtbaren, dafür aber umso empfindlicheren Börse. Was für ein elementares Bedürfnis! Alles schreit nach sozialer Anerkennung, Bestätigung, Hierarchie. Je mehr die Kriterien dafür abhanden kommen, in Fäulnis übergehen – gerade für Künstler und Intellektuelle eine äußerst heikle Sache – springen die wenig zimperlichen Stuntmen der Society in die Bresche, die Klatschkolumnisten. Von der bangen Frage der Leute nach Sein oder Nichtsein, nach dem eigenen gesellschaftlichen Wert, mit einem Wort, von der Existenzangst leben, ebenso wie die „in“-Lokale, auch die Adabeis einer Presse, die vom Regenbogen auf den Revolver gekommen sind. Freilich müssen sie in Wien mit zwei, drei Handvoll Namen ihr Auslangen finden; der Terror des Immergleichen. Ständig kaut diese scheinbare Scene ein paar fettgedruckte Typen wider. Öfter als anderswo mischen sich dabei bankrotte Wirtschaftstreibende, Zuhälter, Desperados aller Berufe unter die sogenannte Prominenz.
Woran erinnert der Markt, wenn nicht an den Tod? Darum haben manche Lokale sowas lebendig Begrabenes. Außer der allgemeinen Niedergeschlagenheit bieten sie, zumindest in Wien, meist ein dürftiges, teures Essen. Je schlichter, desto schicker! lautet die Parole, weil’s an Haus- und Handgemachtes erinnern soll, und ist dann doch nur eine Parodie der Arbeiter- & Bauernküche… Ach, diese ewigen Krautfleckerln, Kasnudeln, Grammelknödel! So ärgerlich wirkt der vermeintliche ideologische Abstand zu McDonalds wie Hilton-Grill, daß einem von vornherein der Magen wehtut.
Wie dem Mief entkommen? Der dünne, teure Wein dieser Lokale, getarnt wenn’s hochkommt, als Meßwein, Diabetikerwein, Prälatenwein, hat einen bitteren Nachgeschmack, hols der Teufel. Nicht nur moralinsauer… Die Geprellten sitzen Schulter an Schulter unter zugigen Schwibbögen und versuchen verzweifelt, sich vollaufen zu lassen. Schwere Krankheiten brechen aus.
„Ohne die Wiener Proletenkultur zu verherrlichen – aber deren letzte Beisln sind mit den Schickeria-Lokalen kaum in einen Topf zu werfen.“
Beim sogenannten Nobelheurigen, einer andern Geißel des Abendlands, wird der wäßrige Wein wenigstens wegen der Autofahrer ausgeschenkt, die sollen auch noch sicher heimkommen.
Die unersättliche Industrie greift nach den elementarsten Bereichen des Lebens: Das sinnliche Vergnügen an Essen und Trinken soll ausgemerzt, jeder Genuß abgewürgt werden.
Ohne die Wiener Proletenkultur zu verherrlichen – aber deren letzte Beisln sind mit den Schickeria-Lokalen kaum in einen Topf zu werfen. Die gutherzigsten Leute trifft man dort, die Kartler, Säufer, Randalierer. Zum Beispiel im „Grünen Baum“ (im vierten Bezirk), wo die hagere Wirtin, ein schmuddeliges Wolltuch um die Ohren, zwischen Kühlschrank und Küche rumschlurft; sie macht das exzellenteste Reisfleisch von Wien, halb geschenkt, und ihr Neffe, der Vickerl, schupft den Laden, der von Bauarbeitern, Jukebox und Fernseher dröhnt. Doch Vorsicht! Wenn sich’s rumspricht und nach und nach die Scene-Leute einmarschieren, ist’s aus und vorbei: kein Platz mehr zu kriegen, ein neuer, zusätzlicher Ober wird eingestellt, die Küche verfällt, das Beisl geht flöten. Es wird renoviert.
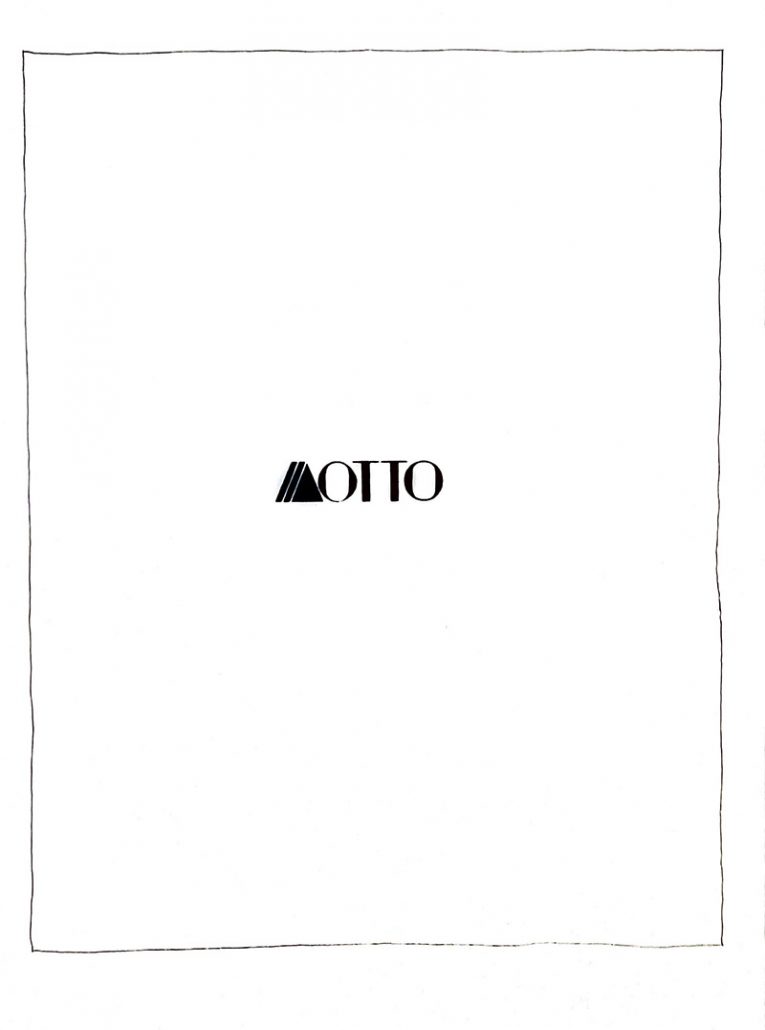
Das Wirtshaus wird wieder zum Gotteshaus, aus dem Beisl wird ein Lokal. Dann ist es nicht mehr wiederzukennen. Statt der blanken Holzbänke, prächtig zum Sitzen, gibt es Marterwerkzeuge als Sessel, klebrige Plastikpolster unterm Hintern, oder affige Schaumstoffkissen, die immer verrutschen. Dazu jeder nur erdenkliche Schnickschnack, häßliche Tapeten und Clos mit Schillingeinwurf, und vor allem grobe Geschäftsführer und grantige Wirtsleute, die nur das Abzahlen vom Kredit im Sinn haben. Im Gegensatz dazu haben Lokale, die einstmals „in“ waren und es nun durch eine Laune der Gesellschaft nicht mehr sind, einen ungeheuren, geradezu metaphysischen Reiz. Sind das nicht vielleicht die Allerschönsten? Auch das „Gutruf“ wird bald dazu zahlen.
In einer gehobeneren Sphäre ist der neue „Regenwurm“(Singerstraße) für das Wüten der Einrichter und Designer ein besonders abschreckendes Beispiel. Das Lokal ist bis zum Erbrechen mit einer gewissen Art-Decó vollgestopft und gehangt. Oder was man sich vage unter Kubismus vorstellen mag, alles nur Glas und Metall. Ein Puppenschuppen! Die Gäste sind wohl als bloße Staffage gedacht, als permanente Vernissagenbesucher; das allerwichtigste ist das Mobiliar. Sollte man nicht auch ehrfürchtig-gedämpft sprechen? Und tatsächlich: Wenn’s ein bißchen lauter zugeht, einer was rezitiert, eine hellauf lacht, wird sogleich ermahnt, gezischt, abkassiert. Oder ist Vorsicht am Platze, daß einem nicht durch das bißchen Lärm die schweren Metalldinger auf den Kopf knallen? Der obligat giftige Weißwein wird übrigens in idiotischen winzigen Krüglein mit Henkel serviert, fehlt nur noch das weggespreizte Fingerchen.
Die Gäste rächen sich auf ihre Weise: Beim Abschied stecken sie die ganze Pretiosität in ihre Manteltaschen.
”Wer in ein Lokal geht, sucht die Leere, die Isolation, die Unordnung, den Dreck.“
Wer in ein Lokal geht, sucht die Leere, die Isolation, die Unordnung, den Dreck. Alles andere, schmiedeeiserne Lampen, karierte Tischtücher, adrette Speisekarten, stellen nur unzulängliche Versuche dar, die Wahrheit zu vertuschen, und beleidigen die Intelligenz. Nackte Tischplatten müssen es sein! Verrußte, kahle Wände, Ofenröhren mitten durch den Raum! Überhaupt die trostlose Atmosphäre von Bahnhofswartesälen! Denn so ist das Leben. Nur kein Zierat, keine sogenannte Gemütlichkeit, keine gerafften Gardinen vor dem Fenstern … wir möchten untertauchen, das perfekte Vergessen, den Exzeß der Unkultur.
Wir wird ein Lokal zum „In“-Lokal? Es wird ausgerufen, wie ein neuer König, und Journalisten erfüllen die Funktion des Hofstaats. „Oswald & Kalb“ in der Bäckerstraße wurde nicht umsonst von der „Krone“ lanciert. Die führende Klatsch & Tratschtante Wiens präsentierte diesen Auerbachschen Keller gleich nach der Eröffnung in einer Liste dessen, was fur das Jahr 1980 „in“ sein wurde (neben einem Dutzend trübseliger Namen und Figuren). Zugleich rückte Rudi Wein’s altgedientes „Gutruf“ in den „out“-Katalog – ein Männerbundlokal von echtem Schrot und Korn, wo vor allem das Establishment des Fernsehens verkehrte und dort auch zweifellos unter sich war. Frauen hatten praktisch keinen Zutritt. Adabei hat oft genug in Wort und Bild diesen Schaum der Menschheit vorgeführt.
Was unserern Blicken also jahrelang durchs „Gutruf“ gnädig entzogen war – • verfettete Josefstadtschauspieler, die Hausfaschisten verschiedener Gazetten, sämtliche leibhaftigen Weiberfeinde – beginnt sich nun in der Bäckerstraße einzufinden „Oswald & Kalb“, unter den größten
Opfern von Kurt Kalb und seiner Freundin Evelyn Oswald auf dem historischen Gewölbe der ehemaligen Greißlerei Lindinger errichtet, soll die gute, alte Wiener „Beislgemütlichkeit“ wiederbeleben helfen.
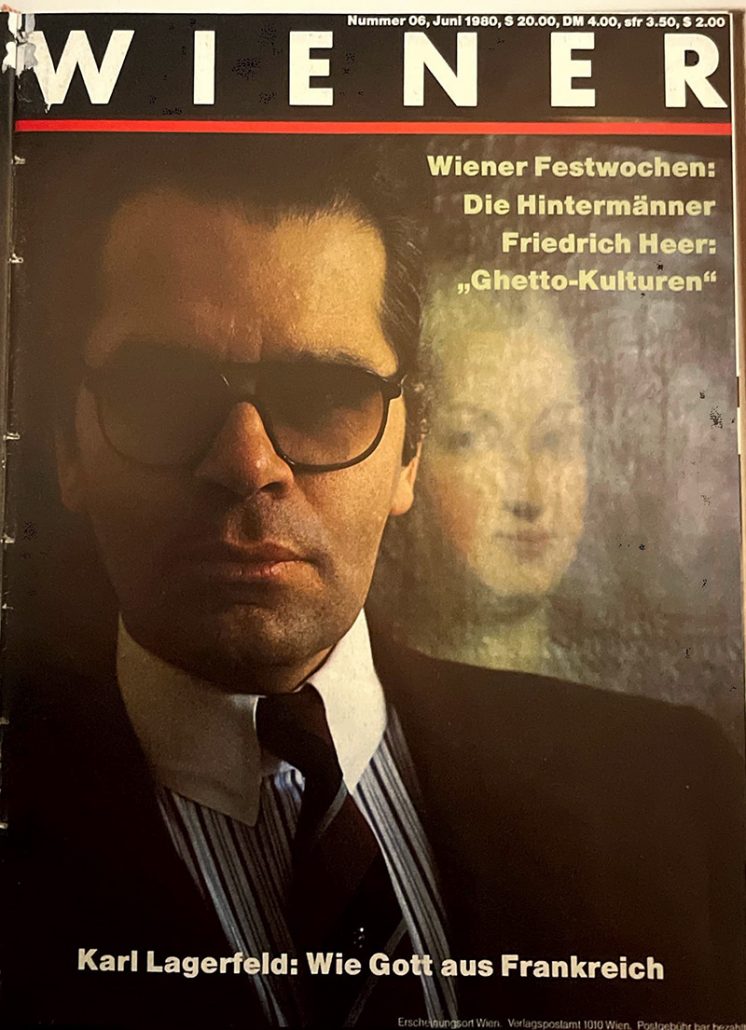
Aber „in“-Lokale entalten ihre eigene fatale Dynamik. Weder Oswald noch Kalb scheinen sich sehr dagegenzustemmen. Es beginnt schon damit, daß an der Eingangstür ein Schild hängt mit der Aufschrift: „Sperrstunde 22 Uhr“. Wer nimmt das ernst? Eine sehr frühe Stunde, da fangt das nächtliche Leben erst an. Durch die unverhüllten Fenster dringt Licht, von der Straße aus kann man drinnen die Leute gedrängt sitzen sehen, ohne Hast trinkend, ohne Gedanken an Aufbruch plaudernd, lachend, also mittendrin in der besten Stimmung. Die Tür ist verschlossen, man klopft, man rüttelt. Vor dem Einlass Begehrenden baut sich ein reziproker Hinausschmeißer auf, der Hineinlasser. Attila, so heißt er, vollstreckt die soziale Kontrolle über den neuen Gast. Kellner sollen ja geübte Menschenkenner sein, den richtigen Blick haben fürs Gesellschaftliche und Angepasste.
Was es wiegt, das hat’s. Doch wehe dem Mädchen, das alleine kommt. Seltsame Einlaßriten …
Im Lokal selber herrscht eine Art Ständestaat (in vorgeblich apolitischen Köpfen das natürlichste Modell), dem schon die Architektonik des Lokals Vorschub leistet. Es ist in drei Bereiche geschieden, den allgemeinen – Theke (Stehplätze und winzige Kaffeehaustischchen), den besonderen (grobe, langgestreckte Tische und Bänke) und den intimen (kleinere Bänke und Tische). Frömmelnd konnte man auch sagen: in Vorhimmel, Himmel und Elysium. Jedenfalls drückt die räumliche Trennung gleichzeitig auch eine soziale Hierarchie aus, die strikte eingehalten wird. Die Schranken sind zwar weder sichtbar noch greifbar, dafür aber umso wirksamer
An der Theke gibts immer ein mörderisches Gedrängel, die hoch getürmte Mantelablage versperrt den Weg, und an der Bar flazen sich die längsten und breitesten Kerle, behaupten dort ihren Platz im Stehen. Wir, drei Frauen allein, werden herumgestoßen. Das Elysium ist natürlich bereits von der Family okkupiert und wird gehalten wie eine Bastion; zu den Tischen des Himmels wollen wir uns nicht dazuquetschen, weil dort grade ein besonderes Kultur-Ekel die Ecken besetzt hält. Da wird ein Tischchen auf der winzigen Empore neben dem Tresen frei, endlich!
Sofort schießt der Herr Ober herbei und setzt das Reserviert-Täfelchen drauf. Noch nie haben wir einen so tolpatschigen Kellner erlebt, er rudert mit den Armen, zwängt sich mit Gewall durch die Leute, steigt einem auf die Zehen, versetzt uns Puffe und Kniffe. Na schön! Es gibt ein furchtbar zugiges Eck im Lokal – die Ventilation befindet sich genau über unseren Köpfen. In diesen Winkel werden hier stets die sogenannten einschichtigen Weiber abgeschoben, dort dürfen sich die Mädchen oder Frauen die Füße in den Bauch stehen, die alleine kommen, zu zweit, zu dritt, jedoch ohne männliche Begleitung. Unsere Wangen brennen. Ein alter bereits besoffener Bekannter torkelt vorbei: „Na, Mädels?“
„Übrigens wurde das schöne Interieur dieses einstigen halbvergammelten Künstler-, Penner- und Nuttenlokals anständig verhunzt.“
Mit Müh und Not kriegen wir unser Seidel Bier (schlecht eingeschenkt, ohne Schaumkrone), und der Barkeeper verlangt von uns sofort das Geld. Das macht er sonst, wir passen auf, bei keinem Pärchen oder bei anderen männlichen Gästen. Kurt Kalb, an und für sich ein freundlicher Mensch, doch auch er ein Opfer der Wiener Hysterie, sagt hinter der Theke stehend: „Ich bin solidarisch mit meinem Personal, ich halt zu meinem Personal, immer!“ Ob das nur der vielzitierte amor intellectualis zum Küchenpersonal ist?
Tische hartnäckig freizuhalten während sich rund herum die Gäste stauen – was für ein perfides Kennzeichen der österreichischen Gastronomie! Die Spur reicht jedoch jetzt schon bis nach Berlin In der „Paris-Bar* einem Wiener Ableger, in der auch für Deutschland untypische schleimig-beflissene Ober wirken, stechen dem Nichtsahnenden als erster Gruß aus der Heimat die Reserviert Schilder ins Auge. Übrigens wurde das schöne Interieur dieses einstigen halbvergammelten Künstler-, Penner- und Nuttenlokals anständig verhunzt.
Der Reservierfimmel, all das Klimbim und tamtam mit Türstehern, Schlitzen beim Eingang etwa von Discotheken haben dieselbe geheime Wurzel, die Sucht nach Exklusivität. Sie kann nur gewaltsam erreicht werden. Damit die einen sich drin fühlen können, müssen andere ausgesperrt werden. Jeder Schnösel erkauft sich die Illusion vom unzugänglichen Palast, wenn er in seinem elenden Cliquenlokal hockt. Noch die Gewitzteren ahmen das obsolet gewordene Modell der Logen nach, deren Geheimnistuerei im abgeschlossenen Zirkel, gewissermaßen ihr konspiratives Element, zwar auch zur Wahrung der Exklusivität, doch vor allem als Schutz vor Verfolgung dienen sollte. Die Zeiten sind vorbei. Alles ist zunichte und lebt doch weiter fort in jenen Lokalen, die einen Augenblick lang „in“ sind.






