AKUT
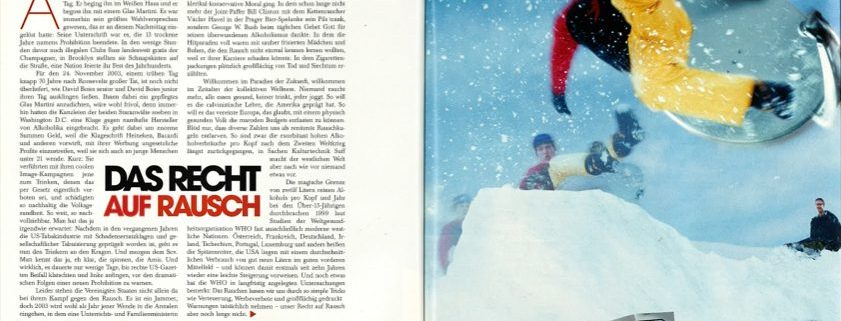
Archiv 2004: Das Recht auf Rausch
Am 5. Dezember 1933 hatte der US-Präsident Franklin D. Roosevelt seinen großen Tag. Er beging ihn im Weißen Haus und er begoss ihn mit einem Glas Martini. Es war immerhin sein größtes Wahlversprechen gewesen, das er an diesem Nachmittag eingelöst hatte: Seine Unterschrift war es, die 13 trockene Jahre namens Prohibition beendete. In den wenige Stunden davor noch illegalen Clubs floss landesweit gratis der Champagner, in Brooklyn stellten sie Schnapskisten auf die Straße, eine Nation feierte ihr Fest des Jahrhunderts.
Text: Eberhard Lauth
Für den 24. November 2003, einem trüben Tag knapp 70 Jahre nach Roosevelts großer Tat, ist noch nicht überliefert, wie David Boies senior und David Boies junior ihren Tag ausklingen ließen. Ihnen dabei ein gepflegtes Glas Martini anzudichten, wäre wohl frivol, denn immerhin hatten die Kanzleien der beiden Staranwälte soeben in Washington D.C. eine Klage gegen namhafte Hersteller von Alkoholika eingebracht. Es geht dabei um enorme Summen Geld, weil die Klageschrift Heineken, Bacardi und anderen vorwirft, mit ihrer Werbung ungesetzliche Profite einzustreifen, weil sie sich auch an junge Menschen unter 21 wende. Kurz: Sie verführten mit ihren coolen Image-Kampagnen jene zum Trinken, denen das per Gesetz eigentlich verboten sei, und schädigten so nachhaltig die Volksgesundheit. So weit, so nachvollziehbar. Man hat das ja irgendwie erwartet: Nachdem in den vergangenen Jahren die US-Tabakindustrie mit Schadensersatzklagen und gesellschaftlicher Tabuisierung geprügelt worden ist, geht es nun den Trinkern an den Kragen. Und morgen dem Sex. Man kennt das ja, ein klar, die spinnen, die Amis. Und wirklich, es dauerte nur wenige Tage, bis rechte US-Gazetten Beifall klatschten und Linke anfingen, vor den dramatischen Folgen einer neuen Prohibition zu warnen.
Leider stehen die Vereinigten Staaten nicht allein da bei ihrem Kampf gegen den Rausch. Es ist ein Jammer, doch 2003 wird wohl als Jahr jener Wende in die Annalen eingehen, in dem eine Unterrichts- und Familienministerin Kinder statt Partys einforderte, dafür verlacht wurde, aber trotzdem noch immer erste Blockflöte spielte, wenn es um klerikal-konservative Moral ging. In dem schon lange nicht mehr der Joint-Paffer Bill Clinton mit dem Kettenraucher Václav Havel in der Prager Bier-Spelunke sein Pils trank, sondern George W. Bush beim täglichen Gebet Gott für seinen überwundenen Alkoholismus dankte. In dem Hitparaden voll waren mit sauber frisierten Mädchen und Buben, die den Rausch nicht einmal kennenlernen wollten, weil er ihrer Karriere schaden könnte. In dem Zigarettenpackungen plötzlich großflächig von Tod und Siechtum erzählten. Willkommen im Paradies der Zukunft, willkommen im Zeitalter der kollektiven Wellness. Niemand raucht mehr, alle essen gesund, keiner trinkt, jeder joggt. So will es die calvinistische Lehre, die Amerika geprägt hat. So will es das vereinte Europa, das glaubt, mit einem physisch gesunden Volk maroden Budgets entlasten zu können. Blöd nur, dass diverse Zahlen uns als renitente Rauschkugeln entlarven. So sind zwar die exorbitant hohen Alkoholverbräuche pro Kopf nach dem Zweiten Weltkrieg längst zurückgegangen, in Sachen Kulturtechnik Suff macht der westlichen Welt aber nach wie vor niemand etwas vor. Die magische Grenze von zwölf Litern reinen Alkohols pro Kopf und Jahr bei den Über-15-Jährigen durchbrachen 1999 laut Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO fast ausschließlich moderne westliche Nationen. Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Tschechien, Portugal, Luxemburg und andere heißen die Spitzenreiter, die USA liegen mit einem durchschnittlichen Verbrauch von gut neun Litern im guten vorderen Mittelfeld – und können damit erstmals seit zehn Jahren wieder eine leichte Steigerung vorweisen. Und noch etwas hat die WHO in langfristig angelegten Untersuchungen bemerkt: Das Rauchen lassen wir uns durch so simple Tricks wie Verteuerung, Werbeverbote und großflächig gedruckte Warnungen tatsächlich nehmen, unser Recht auf Rausch aber noch lange nicht. Es gibt keine rauschfreie Gesellschaft. Der Rausch als Ritual ist mindestens so alt wie die Zivilisation selbst und unterscheidet sich nur regional in der Wahl der Mittel – und dank Globalisierung dabei immer weniger. So wie es die Bars dieser Welt mittlerweile überall erlauben, mit Corona oder Tequila, Caipirinha oder Heineken zu betrinken, ist auch die hiesige Gesellschaft schon längst von ursprünglich kulturfremden Drogen wie Haschisch oder Hanf durchdrungen. Achtzehn Prozent der österreichischen Männer und elf Prozent der Frauen ab 15 gaben in einer Studie von 2001 an, dass sie Erfahrungen mit Cannabis hätten. Das ist keine neue Situation: Schon der antike Geschichtsschreiber Herodot wusste von großflächigem europäischem Hanfanbau zu berichten. Und der um 380 vor Christus verschiedene Philosoph Demokrit war bekannt dafür, dass er Hanf am liebsten im Zusammenspiel mit Wein und Myrrhe genoss.
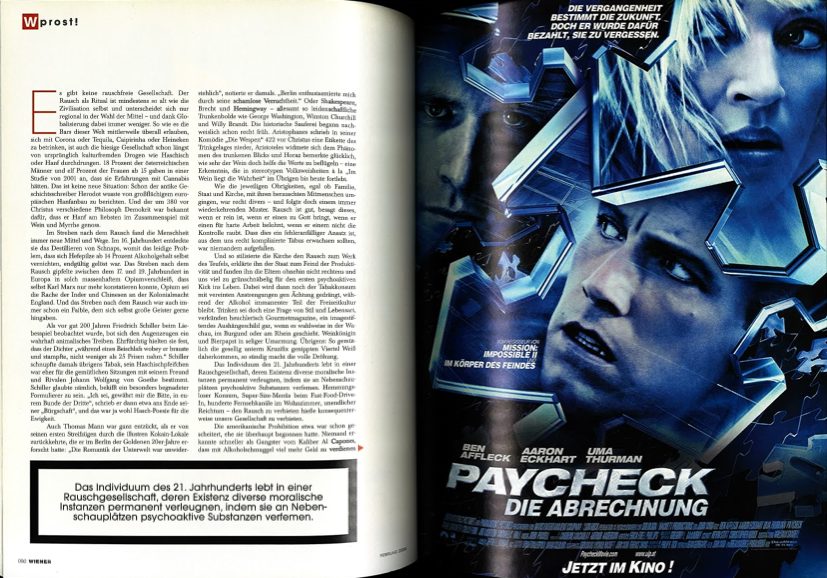
Im Streben nach dem Rausch fand die Menschheit immer neue Mittel und Wege. Im 16. Jahrhundert entdeckte sie das Destillieren von Schnaps, womit das leidige Problem, dass sich Hefepilze ab 14 Prozent Alkoholgehalt selbst vernichten, endgültig gelöst war. Das Streben nach dem Rausch gipfelte zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert in Europa in solch massenhaftem Opiumverschleiß, dass selbst Karl Marx nur mehr konstatieren konnte, Opium sei die Rache der Inder und Chinesen an der Kolonialmacht England. Und das Streben nach dem Rausch war auch immer schon ein Faible, dem sich selbst große Geister gerne hingaben. Als vor gut 200 Jahren Friedrich Schiller beim Liebesspiel beobachtet wurde, bot sich den Augenzeugen ein wahrhaft animalisches Treiben. Ehrfürchtig hielten sie fest, dass der Dichter „während eines Beischlafs, wobei er brauste und stampfte, nicht weniger als 25 Prisen nahm.“ Schiller schnupfte damals übrigens Tabak, sein Haschischpfeifchen war eher für die gemütlichen Sitzungen mit seinem Freund und Rivalen Johann Wolfgang von Goethe bestimmt. Schiller glaubte nämlich, bekifft ein besonders begnadeter Formulierer zu sein. „Ich sei, gewährt mir die Bitte, im Bund der Dritte“, schrieb er dann etwa ans Ende seiner „Bürgschaft“, und das war ja wohl Hasch-Poesie für die Ewigkeit. Auch Thomas Mann war ganz entzückt, als er von seinen ersten Streifzügen durch die illustren Kokain-Lokale zurückkehrte, die er Berlin der Goldenen 20er-Jahre erforscht hatte: „Die Romantik der Unterwelt war unwiderstehlich“, notierte er damals. „Berlin enthusiasmierte mich durch seine schamlose Verruchtheit.“ Oder Shakespeare, Brecht und Hemingway – allesamt so leidenschaftliche Trunkenbolde wie George Washington, Winston Churchill und Willy Brandt. Die historische Sauferei begann nachweislich schon recht früh. Aristophanes schrieb in seiner Komödie „Die Wespen“ 422 vor Christus eine Etikette des Trinkgelages nieder, Aristoteles widmete sich dem Phänomen trunkener Blicke und Horaz bemerkte glücklich, wie sehr der Wein doch helfe, die Worte zu beflügeln – eine Erkenntnis, die in stereotypen Volksweisheiten à la „Im Wein liegt die Wahrheit“ im Übrigen bis heute fortlebt.
Wie die jeweiligen Obrigkeiten, egal ob Familie, Staat und Kirche, mit ihren berauschten Mitmenschen umgingen, war recht divers – und folgte doch einem immer wiederkehrenden Muster. Rausch ist gut, besagt dieses, wenn er rein ist, wenn er einen Gott bringt, wenn er einen für harte Arbeit belohnt, wenn er einem nicht die Kontrolle raubt. Dass dies ein fehleranfälliger Ansatz ist, aus dem uns recht komplizierte Tabus erwachsen sollten, war niemandem aufgefallen. Und so stilisierte die Kirche den Rausch zum Werk des Teufels, erklärte ihn der Staat zum Feind der Produktivität und fanden ihn die Eltern ohnehin nicht rechtens und uns viel zu grünschnäbelig für den ersten psychoaktiven Kick ins Leben. Dabei wird dann noch der Tabakkonsum mit vereinten Anstrengungen in Ächtung gedrängt, während Alkohol immanenter Teil der Freizeitkultur bleibt. Trinken sei doch eine Frage von Stil und Lebensart, verkünden heuchlerisch Gourmetmagazine, ein imagestiftendes Aushängeschild gar, wenn es wahlweise in der Wachau, im Burgund oder am Rhein geschieht. Weinkönigin und Bierpapst in seliger Umarmung. Übrigens: So gemütlich die gesellig unterm Kruzifix genippten Viertel Weiß daherkommen, so sündig macht die volle Drohung.
Das Individuum des 21. Jahrhunderts lebt in einer Rauschgesellschaft, deren Existenz diverse moralische Instanzen permanent verleugnen, indem sie an Nebenschauplätzen psychoaktive Substanzen verfemen. Hemmungsloser Konsum, Super-Size-Menüs beim Fast-Food-Drive-In, hunderte Fernsehkanäle im Wohnzimmer, unendlicher Reichtum – den Rausch zu verbieten hieße konsequenterweise unsere Gesellschaft zu verbieten. Die amerikanische Prohibition etwa war schon gescheitert, ehe sie überhaupt begonnen hatte. Niemand erkannte schneller als Gangster vom Kaliber Al Capones, dass mit Alkoholschmuggel viel mehr Geld zu verdienen war als mit schnöder Schutzgelderpressung. Diese heute zum Hollywood-Mythos verklärten Gesellen mit ihrem kruden Ehrenkodex taten schließlich nichts anderes, als dem Volk das zu liefern, was ihm der Staat versagte: den Rausch. Und der illegale Fusel ermöglichte es anfänglich marginalen Mafiagruppen, zu einer Art vierten Macht im Staat heranzureifen, die Politiker ebenso wie Richter und Polizeipräsidenten auf ihrer Schmiergeldliste stehen hatte. Und das per Verbot geschützte Volk? Besoff sich statt mit Bier und Wein eben mit dubiosem Schwarzgebrannten, starb in Massen an dessen lebensgefährlichen Nebenwirkungen oder wurde zumindest blind, gelähmt und schwachsinnig. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Franklin D. Roosevelt die erste rauchfreie Gesellschaft der Geschichte für gescheitert erklären musste.

Die in Berlin lebende Koreanerin Mun-Ju Kim kann mit Alkohol nichts anfangen. Das hat einen genetischen Grund, ihr fehlt das Enzym Alkoholdehydrogenase, das den Alkohol abbaut. Selbst wenn Mun-Ju Kim nur kleine Mengen Wein oder Bier trinkt, bekommt sie Schweißausbrüche, Sehstörungen und muss sich übergeben. Wenn andere mit einer schönen Flasche Roten entspannen, greift sie daher zum Haschisch. Nur ist das leider illegal, und Mun-Ju findet das ungerecht, weil ihr per Gesetz verboten wird, sich berauschen zu können, wie es ihr am bekömmlichsten ist. Sie zog vor drei Jahren vor Gericht, um die Erlaubnis für legalen Cannabis-Kauf zu erstreiten und wurde natürlich abgewiesen. Trotzdem kämpft sie noch immer für ihr Recht und hat sich heute mit ihrer Internet-Plattform als eines der bekanntesten Sprachrohre für die Cannabis-Legalisierung in Deutschland etabliert. „Ich will nicht mehr kriminalisiert werden, nur weil ich am Wochenende mit meinen Freunden einen Joint rauche“, sagte sie unlängst in einer Talkshow. Soll heißen: Mun-Ju Kim fordert ihr Recht auf Rausch.
Der griechische Philosoph Platon würde sie vermutlich besser verstehen als deutsche Judikatur, lebte aber leider knappe zweieinhalb Jahrtausende zu früh. Vermutlich um 428 vor Christus auf der Insel Aigina geboren, gründete er 387 eine Schule und dachte auch vorher schon viel nach. Über die Bedeutung des Rausches zum Beispiel: Der entstünde aus dem menschlichen Streben nach Glück, sagte Platon. Nur scheitert dabei das Individuum gerne an dem feinen Unterschied zwischen Glück und Lust. Es wählt den Rausch als Mittel zum Zweck, um zum Glück zu gelangen, kennt dabei nur mehr Ziel, aber nicht mehr Maß, feiert Feste, badet in Wein, trinkt ein Bier zu viel, raucht vielleicht gar einen Joint und erreicht dann doch nur Lust, die blöderweise irgendwann in Unlust kippt.
Die Wahrheit des Rausches, so Platon, sei seine Unwahrheit. Womit wir beim alten Problem wären, dass nicht alles ist, wie es scheint – und in der Erkenntnis für Mun-Ju Kim und all die anderen auch nicht viel weiter. Dass Platon nebenbei auch den heilsamen göttlichen Rausch nennt, die Manie der Dichter, den prophetischen und dionysischen Rausch und die Erotik, ist eine andere Geschichte. Der wirkt nämlich nur durch diverse Götter der griechischen Mythologie – und Rausch plus Religion, diesen unguten Cocktail kennen wir schon.
Georges Bataille, ein französischer Dichter und Denker, der 1962 verstarb, sah das Problem von Wahrheit und Unwahrheit etwas anders als Platon – und schlug doch in eine ähnliche Kerbe. Sein schmales Werk muss bis heute als Standard der avancierten Gegenkultur herhalten, weil Bataille sich als Apologet des Rausches, als exzessiver Mensch, der auch noch gerade denken kann, also als Held – verstehen lässt. Grund dafür ist neben anderen sein Buch „L’Expérience intérieure – Die innere Erfahrung“, das 1934 erschien. Von metaphysischem Brimborium hält Bataille darin ebenso wenig wie vom Begriff des Subjekts. Subjekte gäbe es doch gar nicht, schreibt er. Um das zu kennen, brauche es nur eine extreme Erfahrung, einen ordentlichen Rausch seiner Meinung nach, und schon lande man in der eigentlichen Welt dahinter, beim ewig Gültigen, bei der unabhängigen Wahrheit, kurz: dort, wo auch Platon zweieinhalb Jahrtausende zuvor schon hinwollte, aber noch Götter dazu brauchte. Dort, wo vielleicht auch Mun-Ju Kim hinwill, ohne dafür kriminalisiert zu werden. Dort, wo wir alle vielleicht gelegentlich hinwollen, ohne dafür Tabus zu übertreten.
Egal ob philosophische Wahrheitssuche oder Entspannung nach Feierabend: Wer dem Menschen das Recht auf seinen individuellen Rausch aberkennt, nimmt ihm damit auch das Recht auf seine individuelle Existenz, die im Extrem auch in der Selbstzerstörung enden kann. Und wie zeigte schon die Geschichte: Keine noch so restriktive Gesetzgebung, keine noch so ausgefeilte soziale Kampagne kann dazu führen, dass sich nicht doch jemand dafür entscheidet, sich an einer Substanz zu berauschen, die das Gros der Gesellschaft nicht so toll findet. Wem das Recht auf Rausch verwehrt wird, der nimmt es sich trotzdem. Früher. Und später.






