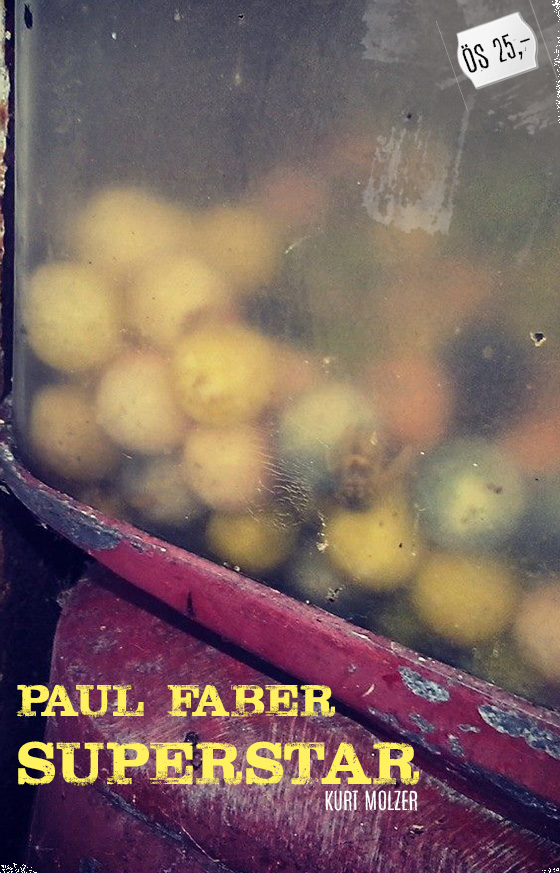KULTUR

PAUL FABER SUPERSTAR
Kurt Molzers fabelhafter Fortsetzungs-Roman, vorerst exklusiv im WIENER (print und online) zu verfolgen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind übrigens rein zufällig … PAUL FABER SUPERSTAR
Kapitel 1
Ganz viele Menschen, die so gut wie nichts erleben, außer dass sie morgens aufstehen und sich abends
wieder hinlegen und zwischendurch einer stupiden Arbeit nachgehen und was essen und es dann wieder rauskacken, behaupten von sich: „Was ich schon alles erlebt habe, ich könnte ein Buch schreiben.“ Aber natürlich werden sie außer Einkaufslisten und Whatsapp-Schwachsinn nie was schreiben, denn abgesehen davon, dass ihr Leben tatsächlich nichts anderes ist als die von Arthur Schopenhauer beklagte Leere – „Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer, von außen gesehen, und wie dumpf und besinnungslos, von innen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.“ –, abgesehen davon also kriegt ein Großteil dieser Möchtegern-Autoren ja keinen geraden deutschen Satz gebacken.
Ich hingegen, Paul Faber, geboren am 23. Juni 1970 in der Ignaz-Semmelweis-Frauenklinik im 18. Wiener Gemeindebezirk, kann wirklich außergewöhnlich gut schreiben, und ich habe Sachen erlebt und aufgeführt, ich sage es Ihnen, ich wäre doch der größte Trottel, habe ich mir oft genug gesagt, würde ich das nicht alles irgendwann zu Papier bringen! Und lassen Sie mich an dieser Stelle doch bitte gleich den Beweis antreten, dass ich kein Angeber und Dampfplauderer bin: Passen Sie auf, am 30. Juli 2007 druckte Europas größte Tageszeitung, die deutsche „Bild“ nämlich, in riesigen Lettern folgende Schlagzeile: „SCHICKSAL IMPOTENZ“. Die Unterzeile lautete: „Männer brechen ihr Schweigen“.
Es war eine der erfolgreichsten „Bild“-Schlagzeilen aller Zeiten, die Auflage erreichte Rekordhöhen. Fünf Männer, die sich sogar fotografieren ließen, erzählten in dieser Serie frei von der Leber weg und in allen Einzelheiten und noch dazu unter ihremrichtigen Namen, dass sie keinen hochkriegen und wie verzweifelt sie sind und wie ihre Frauen damit umgehen und überhaupt – mein Leben als Schlappschwanz halt. Der Ansturm auf die Kioske und Zeitschriftenläden und das Echo waren so enorm, dass die Redaktion sich zur Einrichtung einer Hotline entschloss. Betroffene und deren Frauen konnten anrufen, Urologen und Psychologen gaben Ratschläge.
Der Autor dieser Serie war – ich. Und wissen Sie was? Die Serie war erstunken und erlogen von der ersten bis zur letzten Zeile! Die ach so armen Impotenten waren Arbeitslose und Geringverdiener, die ich in leicht verlotterten Kneipen an der Reeperbahn ansprach. Ich zahlte jedem ein sogenanntes Informationshonorar in Höhe von 500 Euro – dafür durfte ich dann schreiben, was mir beliebte. In besagtem Jahr 2007 war ich sechs Monate lang freier Mitarbeiter in der Hamburger Zentralredaktion der „Bild“-Zeitung. Sie blätterten mir 9.000 Euro hin, pro Monat. Ich kannte den Chefredakteur von früher und wollte die Zeit bis zum Antritt eines neuen Jobs in München überbrücken. Als die sechs Monate fast um waren, hatte ich immer noch keinen richtigen Knüller abgeliefert. Eines Abends saß ich mit einem Redaktionskollegen schon ziemlich betrunken in einem Lokal in der Kaiser-Wilhelm-Straße, schräg gegenüber vom Springer Verlag. Nach dem fünften Bier sagte ich zu ihm: „Ich mach eine Story über Impotente, über Typen, die ihre Pimmel nur zum Pissen gebrauchen können, schwebt mir schon lange vor, hab ich noch nirgendwo gelesen. Ich werde fünf Typen auftreiben, und die sollen mir alles erzählen über ihre Hardwareprobleme. Mega-Story, ganz Deutschland wird darüber reden! Schlage ich morgen in der Themenkonferenz vor.“ Der Kollege blickte nur gelangweilt von seinem Bier hoch: „Kriegst du nie rund, redet doch keiner über sowas Peinliches.“ – „Wetten?“ – „Okay, wieviel?“ – „Tausend Euro, Handschlag.“ Er schlug ein, und am nächsten Tag lachten sie mich alle aus im großen Konferenzraum. „Na klar“, meinte einer aus der Riege der Chefredaktion, „und nächste Woche interviewst du Elvis Presley, weil der lebt ja angeblich noch.“
Zwei Wochen später hatte ich sie dann doch rund, meine Story. „Also ich muss zugeben“, lobte mich der mit dem Elvis Presley-Sager, „Herr Faber hat Unglaubliches geleistet, Gratulation!“ Ich wurde als gefeierter Superstar nach München verabschiedet, und von den gewonnenen tausend Euro kaufte ich mir in einer Kunstgalerie eine Nackte in High Heels von Helmut Newton.
Ach so, bevor ich’s vergesse: Die Serie veröffentlichte ich, weil es ein Schwindel sondergleichen war und ich mir meinen Namen nicht versauen wollte, unter dem Pseudonym Kurt Molzer. Den Kerl gibt’s in echt, und der scheint ja, ganz im Gegensatz zu mir, wirklich ein angeberischer Dampfplauderer vor dem Herrn zu sein, der hat früher Kolumnen über seine angeblichen Bettgeschichten und auch ein paar schweinische Bücher geschrieben, der muss ein ziemliches Arschloch sein, vielleicht ein noch größeres als ich, wobei ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher bin, ob man ein Arschloch ist, wenn man die „Bild“ bescheißt, von der man doch so viel Böses schon gehört und gelesen hat. Freilich, man könnte sagen, dass ich nicht nur die Chefredaktion, sondern auch die Leser beschissen habe, wobei sich hier einwenden ließe: „Wer die ‚Bild‘ liest, will beschissen werden.“

Stimmen Sie mit mir überein? Diese Geschichte ist doch wahrlich erzählenswert, nicht? Sie mag schmierig sein, widerwärtig, degoutant, durch und durch amoralisch, ja, aber – nicht langweilig, oder? Und ganz egal wie Sie dazu stehen, so möchte ich Sie gerne fragen: Fühlen Sie sich durch die Geschichte reingezogen in dieses Buch? Ich erlaube mir die Dreistigkeit, für Sie mit einem Ja zu antworten. Und jetzt erzähle ich Ihnen was: Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte ich einen Termin bei einem namhaften Buchverlag in Berlin. Die Cheflektorin von denen hat mir ein E-Mail geschrieben. Sie habe, teilte sie mir darin mit, schon viel von mir gelesen, meine Reportagen in „GEO“, meine Kolumnen in der Schweizer „Weltwoche“ und so weiter, und nun sei die Zeit überreif für das erste Buch Paul Fabers, einen Roman, darauf würden doch alle sehnsüchtig warten! Ob ich denn womöglich nicht schon eine Idee hätte und ein Exposé verfassen könnte? Zwei DIN-A4-Seiten würden völlig ausreichen, ach was, eine! Na gut, ich muss zugeben, ich fühlte mich gebauchpinselt, hockte mich also auf meinen Hintern, schrieb ein paar Gedanken nieder – Exposé wäre weit übertrieben –, schickte es der Dame vorab und flog nach Berlin. Wir saßen dort in so einem sterilen Konferenzraum – hätte auch das Besprechungszimmer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sein können, es standen trockene Kekse und Mineralwasserflaschen auf dem Tisch, ich krieg ja grundsätzlich Brechreiz in Konferenzräumen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, schon in meinen frühen Jahren als Redakteur bei der „Süddeutschen Zeitung“ spürte ich immer wieder den Brechreiz hochkommen in dieser Atmosphäre der aufgesetzten Geschäftsmäßigkeit, der Eitelkeiten der Vorgesetzten und der Angst der Untergebenen vor dem Sichselbstlächerlichmachen und Vorgeführtwerden coram publico. Außer der Cheflektorin waren noch der Boss des Verlagshauses höchstselbst – er trug eine irritierend feminine Brille – und der Programmleiter für Belletristik anwesend, dessen Föhnfrisur sein wichtigtuerisches Gehabe noch zusätzlich betonte. Von Anfang an fielen mir die skeptischen Mienen der beiden Männer und eine nervöse Anspannung im Gebaren der Cheflektorin auf, an der ich übrigens alles sexuell erregend fand bis auf die zu kleinen Augen. Ich trug dann also die Idee für meinen Roman vor, und als ich geendet hatte, fuhr sich der Programmleiter für Belletristik durchs geföhnte Haar und fragte mich: „Schön und gut, aber wo ist der Konflikt am Beginn des Buches? Und wo ist der Spannungsbogen? Ohne Konflikt am Beginn und ohne Spannungsbogen ist es kein Roman. Sorry.“ Das Sackgesicht brachte mich gleich auf 180! War es vielleicht meine Idee, hierher zu kommen? Hab ich mich etwa aufgedrängt? Ich spürte es brennend heiß werden in der Magengegend. „Es gibt keinen Konflikt am Anfang, und einen Spannungsbogen schon gar nicht“, sagte ich. Und dann duzte ich Monsieur Programmleiter schon: „Ich würde sagen, du schiebst dir deine ganzen Konflikte und Spannungsbögen hübsch in den Arsch.“ Sodann erhob ich mich unter den entsetzten Blicken der Anwesenden, empfahl mich, wünschte noch einen angenehmen Tag und verließ den Konferenzraum.
Es dauerte keine zehn Minuten, bis mein Handy klingelte. Die Lektorin war dran, völlig aufgebracht fragte sie mich, ob ich vom wilden Affen gebissen und mir denn hoffentlich darüber im Klaren sei, dass ich hiermit zur Persona non grata erklärt wurde, was ihr ungemein leid tue, da sie mich nämlich für ein „fucking big talent“ halte. „Es ist mir egal, ich will mir diesen Blödsinn nicht anhören, bei einem Roman kommt es nur darauf an, ob ich vom ersten Satz an reingezogen werde und immer weiterlesen will – oder eben nicht. Alles andere ist graue Theorie und interessiert mich einen Scheißdreck“, hielt ich ihr unmissverständlich entgegen. „Machen Sie doch, was Sie wollen“, sagte sie verärgert und legte einfach auf. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich setzte mich ins Taxi, fuhr zum „Cafe Einstein“ unter den Linden, bestellte mir marinierten Tafelspitz mit steirischen Käferbohnen und Kürbiskernöl, dazu ein Glas Grauburgunder, packte meinen Laptop aus und fing an, dieses Buch zu schreiben.
Ich dachte mir: Okay, du hast jetzt zwar keinen renommierten Verlag im Rücken – na ja, um die Wahrheit zu sagen: gar keinen –, aber dafür kannst du ganz uneingeschränkt drauflos tippen, ohne dir über einen Konflikt am Beginn und einen Spannungsbogen Gedanken machen zu müssen. So ein Bucherfolg würde mir halt schon guttun, und meinen Gerichtsvollzieher würde es auch freuen. Der tanzt, nur falls es Sie interessiert, regelmäßig bei mir an und fragt mich immer, ob ich nicht wenigstens mal fünfzig Euro an einen meiner Gläubiger zahlen will, nur um guten Willen zu zeigen. Kommt doch überhaupt nicht in Frage, lehne ich stets brüsk ab, was hätten denn läppische fünfzig Euro für einen Sinn bei rund einer halben Million an Schulden,Finanzamt und Banken und so, und mach dem Mann ein Bier auf um acht in der Früh und mir auch eins und er ist zufrieden und hält das Maul. Ja, so ein richtiger Bucherfolg, mit Übersetzungen in andere Sprachen und einer Verfilmung gar, mein Gott, wär das schön! Wär das schön!
Der geneigte Leser fragt sich womöglich verwundert: Wie kann denn ein ehemaliger Redakteur der hochangesehenen „Süddeutschen Zeitung“, ein Autor von Publikationen nicht minderen Ranges wie „GEO“ und der „Weltwoche“ („Bild“ lassen wir jetzt mal schön weg), ein „fucking big (Schreib)talent“, ständig Besuch von einem Gerichtsvollzieher bekommen und mit selbigem auch noch in aller Herrgottsfrühe Bier saufen? Das geht ganz einfach, sage ich Ihnen, man muss nur rechtzeitig damit anfangen, über seine Verhältnisse zu leben. Ich verdiente zwar schon am Beginn meiner sogenannten Karriere überdurchschnittlich viel Geld. Das hatte mehrere Gründe. Erstens war ich zweifellos hochbegabt, mit Anfang zwanzig schrieb ich Sätze wie diesen: „Der stolze, an die zwei Meter große Häuptling vom Stamm der Cherokee, der mir mit seinem beeindruckenden und in den buntesten Farben leuchtenden Federschmuck plötzlich an der Flussmündung gegenüber-stand und den Weg nach Alabama erfragte, war in Wahrheit Frau Helene Pospischil, meine kleine verhutzelte 86-jährige Wiener Nachbarin mit den braunen Stützstrümpfen und dem Haarnetz, und sie stand vor meiner Wohnungstür und überreichte mir mit ihren zittrigen Händen ein Einmachglas mit Bügelverschluss, worin frisch gemachtes Apfelkompott hin und her schwappte, und sie sagte: ‚Wohl bekomm’s, Herr Faber.‘“ Die Passage entstammt einem LSD-Selbsterfahrungsbericht, erschienen Anfang der 1990er Jahre in einem überaus populären Zeitgeist-Magazin. Zweitens konnte ich mich blendend verkaufen. In sehr gewähltem Deutsch, Bühnen-Deutsch fast schon möchte man sagen, erzählte ich in Bewerbungsgesprächen von meinen ersten Schritten im Journalismus – ich verantwortete den Inhalt der Schülerzeitung des Bundesrealgymnasiums in der Hegelgasse, welche während meines Wirkens als die Beste ihrer Art galt – und artikulierte profund und präzise meine Vorstellungen von einem guten Text. Drittens wirkte ich älter, was in erster Linie meiner Bekleidung geschuldet war. Schon in jungen Jahren trug ich englische Zweireiher mit Goldknöpfen und Seidenkrawatten sowie rahmengenähte Schuhe. Wenn ich mir heute meine alten Fotos ansehe, denke ich allerdings: zum in die Fresse schlagen, der aufgeblasene Wichser.
Kapitel 2
Ich aufgeblasener Wichser interviewte aber immerhin, da war ich gerade einmal dreiundzwanzig Jahre alt, Helmut Kohl im Bonner Kanzleramt. „Birne“, so der in der Bundesrepublik gebräuchliche Spitzname des deutschen Regierungschefs (wegen seines dicken birnenförmigen Schädels nämlich), stand mir zwei Stunden lang Rede und Antwort. Es ging um alles Mögliche, die deutsche Einheit, den versoffenen russischen Präsidenten Boris Jelzin, das Ende der Herrschaft der Liberaldemokratischen Partei in Japan nach 38 Jahren, Pfälzer Saumagen – Kohls Leibspeise, die übrigens auch seine Staatsgäste vorgesetzt bekamen, ob sie wollten oder nicht, Pfälzer Saumagen bis zum Erbrechen, so könnte man es beinahe im Wortsinn sagen, denn gut informierten Kreisen zufolge soll Erich Honecker nach Pfälzer Saumagen zwei Tage lang Durchfall gehabt und sich dabei mehrfach bis übers Kreuz angeschissen haben, jawoll, gebt dem hinterhältigen Kommunisten Honecker nur ja reichlich Pfälzer Saumagen! –, oder die alljährlich in der Presse veröffentlichten Urlaubsfotos des Kanzlers, die ihn jedes Mal auf irgendeiner Alm oberhalb von St. Gilgen am Wolfgangsee und an der Seite seiner kranken und schwer depressiven Frau Hannelore und immer auch abwechselnd mit Hunden, Hühnern, Kühen, Schweinen, Ziegen oder Schafen zeigten. Ich fragte „Birne“, ob er den Aufstieg auf diese Almen aus eigener Kraft bewerkstellige, oder ob aufgrund seines nicht unbeträchtlichen Körpergewichts die Anforderung eines Hubschraubers der Deutschen Luftwaffe vonnöten sei. „Birne“ konnte sich erst nicht zurückhalten und hielt sich die Wampe vor Lachen, aber im Handumdrehen schien ihm klargeworden zu sein, dass es sich um eine Respektlosigkeit sondergleichen handelte, und er meinte, sich die Lachtränen mit einem weißen Stofftaschentuch abwischend: „Also, Faber, ich werde Ihnen diese unglaublich blöde Frage ganz bestimmt nicht beantworten, aber zum Glück haben Sie den Österreicher-Bonus bei mir, und jetzt schauen Sie, dass Sie weiterkommen, ich hab gleich ein Telefonat mit dem 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.“ (womit er Bill Clinton meinte).
Da saß ich also mit dem mächtigsten Mann Europas in dessen Büro – und hatte kein Geld mehr für die Taxifahrt zum Flughafen Köln/Bonn, von wo es zurück nach München gehen sollte. Mein Überziehungsrahmen bei der „Dresdner Bank“ war mehr als ausgeschöpft, man würde mir bis zur Überweisung des nächsten Gehalts am Monatsende keine müde Mark mehr auszahlen, und meine Kreditkarte war gesperrt. Ein kurz zurückliegender Urlaub in der Karibik sowie Kaution, Provision und erste Miete für meine Wohnung mit Stuck, Sternparkett und Flügeltüren im Bezirk Altstadt-Lehel hatten das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich musste also den Bus nehmen, der an ungefähr 798 Haltestellen weitere Fahrgäste aufnahm, die zu arm für ein Taxi waren. Während dieser schleppenden Fahrt erheiterte mich kurz die Vorstellung einer allerletzten, nicht gestellten Frage an Helmut Kohl: „Herr Bundeskanzler, könnten Sie mir eventuell mit fünfzig Mark aushelfen? Ich kann sonst das Taxi zum Flughafen nicht bezahlen. Von der Bank krieg ich nichts mehr.“ Der Kanzler der wohlhabenden Deutschen, der Generalbevollmächtigte einer der führenden Industrienationen der Welt hätte mir nicht geglaubt, so etwas Absurdes wäre für ihn unvorstellbar gewesen, obwohl es nichts als die nackte Wahrheit war. Ich bin mir aber heute immer noch sicher, dass „Birne“ den Fuffi trotzdem lockergemacht hätte.

In München angekommen, hatte ich noch 60 Pfennig in der Tasche. Es war etwa 19 Uhr, ich hatte Hunger, mir knurrte der Magen, aber der Kühlschrank in meiner Luxuswohnung war leer. Was tun? Mir von jemandem Geld zu leihen kam nicht infrage, ich hatte sie doch alle schon angepumpt, Freunde und Arbeitskollegen, die warteten längst auf Rückzahlung. Eine feste Freundin, die mich aus Liebe durchgefüttert hätte, hatte ich damals noch nicht. Ich überlegte deshalb allen Ernstes – wenige Stunden, nachdem ich bei Helmut Kohl im Kanzleramt war und zwei Tage vor Erscheinen meines großen Interviews, auf das sich die Nachrichtenagenturen rund um den Globus stürzen würden; man lasse sich diese beiden Tatsachen unbedingt auf der Zunge zergehen, bevor man jetzt weiterliest – ob es nicht das Gescheiteste wäre, in der Dämmerung oder nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo in der Vorstadt einer alten Frau, aber keiner dicken mit speckigen Armen, die vielleicht Radau gemacht und sich gewehrt hätte, sondern einer dünnen gebrechlichen, die Handtasche zu entreißen und schnell davonzulaufen. Hundert Mark, die sich vielleicht in der Geldbörse gefunden hätten, wären wie ein Goldbarren für mich gewesen, ich wäre gleich anschließend zu „McDonald‘s“ gegangen und am nächsten Morgen zu „Aldi“ oder „Edeka“, um mir billige Fertiggerichte für mehrere Tage zu kaufen. Leute, hatte ich einen Scheiß Hunger! Ich saß auf meinem sündteuren „Terrazza“-Sofa des Schweizer Designers Ubald Klug – ich nenne keinen Preis, sonst greifen Sie sich an den Kopf, wer unbedingt möchte, kann‘s ja googeln, dann sieht man auch gleich, dass Mick Jagger ebenfalls ein „Terrazza“ besitzt, es gibt ein Foto, da hockt der Rolling Stone ziemlich lässig auf diesem Sofa, nur wahrscheinlich mit vollem Magen – und war schon dabei, mir für die Flucht nach dem hoffentlich erfolgreichen Handtaschenraub meine nicht gerade preisgünstigen Laufschuhe zu schnüren. Jäh hielt ich inne. Ich kann das nicht tun, ich habe zwar nicht den besten Charakter, aber ein gutes Herz habe ich ja doch, dachte ich. Will ich denn verantworten, dass eine arme alte Frau vor Schreck womöglich tot umfällt? Raub mit Todesfolge wäre das, Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren, wenn nicht lebenslänglich, wenngleich zweifellos mildernde Umstände zuerkannt würden, da ich dem Opfer kein Messer ins Herz gerammt hätte, die Pumpe ja quasi von allein stehengeblieben wäre. Außerdem erschien mir das Risiko, von der Polizei wenn schon nicht auf frischer Tat ertappt, später aber doch ausgeforscht zu werden, als viel zu groß.
Ich behielt die Laufschuhe an und änderte meinen Plan. Zunächst trank ich langsam drei Gläser Whisky. Ich wollte Zeit verstreichen lassen. Gegen 20.30 Uhr ging ich dann zu Fuß in die Sendlinger Straße, wo sich damals noch die Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ befand. Nur noch der Nachtredakteur hatte Dienst, alle anderen Räume waren leer. Ich fing nun an, in den Kühlschränken aller Ressorts und sämtlichen Schubladen meiner Kollegen nach Essbarem zu suchen. Gierig und wild durcheinander stopfte ich mir dann Joghurt, Schokolade, Müsliriegel, Knäckebrot, Leberwurst in Dosen, Frischkäse und eine schon braungefleckte Banane in den Rachen. Wie ein Bär kam ich mir vor, der in den Wäldern Kanadas in eine einsame Hütte eindringt und dort alles vertilgt, was er vorfindet. Ich wollte den ganzen nächsten Tag satt sein. Übermorgen würde man weitersehen. Während ich mit verklebten Händen fraß, konnte ich es selbst nicht glauben. Was machte ich hier? Wie lebensunfähig war ich eigentlich? Wenn meine Kollegen wüssten, dass ich in ihre Schubladen gehe und ihnen heimlich ihre Lebensmittel wegfresse! Mein Gott, wie grotesk und erbärmlich war das! Die Beute fühlte sich im Magen an wie ein Haufen Steine, mir war schlecht und ich bekam in der darauffolgenden Nacht kein Auge zu. Ja, so war das bei mir schon immer. Ich konnte noch so viel Geld verdienen – da ich jedoch das Doppelte und manchmal das Dreifache davon ausgab, spannte der Pleitegeier von Anbeginn meines Berufslebens seine Flügel über mir aus.
Aber die abendliche Fressorgie in der Redaktion war eine Bagatelle gegen das, was sich in meinem Leben in den nächsten sechs Tagen abspielte. So lange musste ich nämlich noch warten, bis ich frisches Geld vom Verlag bekam. Um nicht zu verhungern mitten in Europa, suchte ich jeden Morgen ein anderes Fünf-Sterne-Hotel auf. Ich steuerte jeweils den Frühstücksraum an – vor 30 Jahren fragte dich am Eingang noch kein mit Liste und Kugelschreiber bewaffneter Mensch nach der Zimmernummer – und fraß von dem reichhaltigen Buffet so viel, dass mein Magen bis zum Abend gefüllt war. Im „Sheraton“ in der Arabellastraße fing ich an, meine zweite Station war das „Park Hilton“ beim Englischen Garten“, am dritten Tag ging ins „Vier Jahreszeiten“ in der Maximilianstraße, Nummer vier war der „Bayerische Hof“ am Promenadeplatz. Wo ich am fünften und sechsten Tag war, weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass ich nach dem überaus köstlichen Frühstück in den „Vier Jahreszeiten“ – es war das Beste von allen, dieser frische zarte Lachs mit dem Meerrettich, ich träum heute noch davon! – einen Termin beim Bayerischen Staatsminister der Justiz hatte. Da ich den Lachs mit reichlich Prosecco hinuntergespült hatte, war ich schon sehr beschwingt um diese vormittägliche Stunde, und anstatt dem Minister aufmerksam zuzuhören, lachte ich mich innerlich tot („Herr Justizminister, ich, Paul Faber, Jungstar bei der „Süddeutschen Zeitung“, komme gerade aus dem Hotel „Vier Jahreszeiten“, wo ich mich eingeschlichen und kaiserlich gefrühstückt habe wie einstmals Elisabeth von Österreich, ohne auch nur einen Pfennig zu bezahlen, und das nicht einmal nur so zum Spaß oder aus Recherchegründen, um unseren Lesern etwa zu zeigen, wie einfach man sich in der versnobten bayrischen Landeshauptstadt ein 30-Mark-Dejeuner gratis einverleiben kann, sondern weil ich blank bin wie Sau und nicht den Kitt aus den Fenstern meiner 120-Quadratmeter-Wohnung fressen will. Wie bewerten Sie das denn, Herr Justizminister?“).
So viel zum Frühstück. Wenn ich dann zu Mittag von einem Redaktionskollegen gefragt wurde, wie es mit einer Pizza beim Italiener wäre, täuschte ich Verdauungsprobleme vor und sagte „Vielleicht nicht so gut“. Am Abend brauchte ich aber wieder was zu beißen – die Zechprellerei ging weiter. In den großen unübersichtlichen Münchner Bierlokalen mit den vielen Sälen, wie zum Beispiel dem „Hofbräuhaus“ und dem „Franziskaner“, hatte ich leichtes Spiel. Ich bestellte mir Rumpsteak, ofenfrischen Jungschweine-Krustenbraten und andere deftige Speisen, selbstverständlich immer mit Vorspeise, Nachspeise und mindestens drei Gläsern Hefe-Weizenbier. Zum Schluss ließ ich mir jedes Mal einen Espresso bringen, obwohl ich damals noch gar keinen Kaffee trank. Ich tat das, um unverdächtig zu erscheinen – ich wollte als einziger Gast bei Tisch, der ein leeres Bierglas vor sich hatte, nicht aufstehen. Man hätte ja denken können, ich wolle mich aus dem Staub machen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Erst wenn die Kellner mir die Espresso-Tasse hinstellten, erhob ich mich vom Stuhl, was sie in den Glauben versetzen sollte, ich ginge zur Toilette. In Wahrheit ging ich zum Ausgang, und als ich draußen war, entfernte ich mich schnellen Schrittes und voller Angst vom Tatort.
Wenn ich es auch nicht übers Herz brachte, eine alte Frau ihrer Handtasche zu berauben, so verfüge ich nichtsdestotrotz, und ich würde meinen: bis zum heutigen Tag, über ein gewisses Maß an krimineller Energie – dies vielleicht ja deshalb, weil meine Eltern Kokaindealer waren. Man kann nun wirklich nicht sagen, es sei ihr erklärtes Berufsziel gewesen, auch machten sie es nur fünf Jahre lang, aber in dieser Zeit bekam ich ein paar filmreife Szenen mit, die sich für immer in mein Gehirn einbrannten und vermutlich mein Wesen unvorteilhaft beeinflussten (davon gleich in aller Ausführlichkeit). Mein Vater war in den 1970er Jahren und auch noch am Beginn der 80er Jahre ein höchst erfolgreicher Werbetexter, und wie etliche seiner Kollegen meinte er, der Kreativität seien durch das Schnupfen von Kokain keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Das stimmte auch, im Drogenrausch textete er Slogans wie „Rum-Kokos von Casali – schluck lieber Zyankali!“ oder „Auf Buchenholz von MAtador brunzt liebend gern der LAbrador!“ (gemeint war das Holzspielzeug von „Matador“, und damit man mit der Betonung richtig lag, schrieb er die erste Silbe jeweils in Versalien). Irgendwann war Schluss mit den kreativen Exzessen, sie feuerten ihn fristlos und ohne Abfindung. Als Arbeitsloser kokste Faber senior nur noch mehr. Er ließ bei seinem Dealer anschreiben und versprach ihm hoch und heilig, bei einer anderen Agentur schnell wieder unter Vertrag zu kommen. Es war nur Wunschdenken, keiner wollte ihn mehr, sein Ruf als „Schneekönig von Döbling“ – unser Wohnort in Wien – eilte ihm voraus. Da sprach der Dealer eines Tages zu ihm: „Arbeite für mich. So kannst du deine Schulden bei mir bezahlen und gleichzeitig ein Vermögen verdienen.“ Worte, die gleichermaßen als Angebot und Drohung zu verstehen waren. Mein Vater, dieser zugekokste Zombie mit dem irren Blick, der aschfahlen Haut und den schwarzen Schatten unter den Augen, der ohne die Droge kein Wort mehr sprechen und keinen Schritt mehr gehen konnte, stimmte diesem Irrsinn zu. Seine Aufgabe bestand künftig darin, das Zeug aus Amsterdam nach Österreich zu bringen – meistens mit dem Flugzeug, manchmal aber auch mit dem Auto über zwei Landesgrenzen! Vater reiste nicht allein als Drogenkurier, er nahm meine Mutter mit. Meine Mutter, die aussah wie Brigitte Bardot und nie was arbeiten musste, hätte immer alles für meinen Vater getan. Wenn mein Vater zu meiner Mutter irgendwann einmal gesagt hätte: „Ich möchte, dass du Tolstois ‚Krieg und Frieden‘ mit der Hand abschreibst, und zwar mit Bleistiften.“ Meine Mutter hätte es getan. Wenn mein Vater gesagt hätte: „Ich möchte, dass du dich nackt auf den Stephansplatz stellst und hundert Mal laut verkündest: ‚Ich liebe nur einen, und dieser eine heißt Oskar Faber!“ Meine Mutter hätte es getan. Wenn mein Vater gesagt hätte: „Ich will, dass du aus meinem Leben verschwindest und dich in der Donau ersäufst.“ Ich fürchte, meine Mutter hätte es getan. So aber sagte er nur zu ihr: „Ich möchte, dass du mich begleitest und dir das Koks in die Vagina steckst. Dann können wir mehr transportieren und mehr verdienen.“ Und meine Mutter machte es, sie steckte sich das Koks in die Vagina, und mein Vater steckte sich’s in den Arsch, und so pendelten sie hin und her zwischen Wien und Amsterdam, fünf Jahre lang, mit „Austrian Airlines“ oder in Vaters grünem Range Rover, und wurden wie durch ein Wunder nie erwischt.
Kapitel 3
An meinem zwölften Geburtstag erfuhr ich von Vaters Drogensucht. Lange schon hatte ich mich gefragt, warum er so wenig aß und seine Nase immer rann und seine Stimme ständig so belegt war und warum er so wenig schlief und stattdessen ganze Nächte im Wohnzimmer laut Musik hörte (bevorzugt den wuchtigen Soul-Rock von Rare Earth, der einzigen weißen Band des berühmten Motown-Labels). Am 23. Juni 1982 hatte ich ein paar Freunde eingeladen, darunter auch die Tochter unserer Nachbarn, in die ich ein wenig verliebt war. Auf der Geburtstagstorte brannten die Kerzen und alle sangen „Happy Birthday to you…!“. Mein Vater stand zwischen meiner Mutter und mir. Er hatte seine Arme um unsere Schultern gelegt und übertönte uns mit seinem falschen aufgekratzten Gejohle. Als „Happy Birthday to you…!“ Gott sei Dank zu Ende war – wie ich es hasste und immer noch tue –, lachte er hysterisch und fing wie verrückt zu klatschen an. Er drückte mich dann so fest gegen seine Brust, dass mir die Luft wegblieb. Anschließend nahm er meinen Kopf zwischen seine Hände und starrte mich an. Ich sah in seine irren Augen. Es hatte was Bedrohliches. Pupillen so groß wie Zehn-Schilling-Münzen. Dann presste er seine Lippen gegen meine und gab mir einen abnormal langen Kuss. Und als er endlich losließ, entglitten ihm jene Worte, die ich bis ans Ende meiner Tage nicht vergessen werde und die damals den Wunsch in mir weckten, auf der Stelle tot umzufallen: „Ach, Kindergeburtstage! Schon schön, aber ich freu mich, wenn der Pauli größer ist, wenn er sechzehn ist, ein junger Mann halt. Ich kann’s gar nicht erwarten. Wisst ihr, was ich meinem Sohn zum sechzehnten Geburtstag schenken werde? Da kommt ihr nie drauf, na….! Ich sag’s euch: eine ganz schöne und ganz liebe Frau Hure, die schönste und liebste Hure von Wien, hahaha!“ Worauf er mich noch einmal an sich heranzog und mein ganzes Gesicht so derartig übertrieben mit Küssen bedeckte, als wäre ich ein nach zehn Jahren aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrter Soldat. Er hatte jegliche Kontrolle über sich selbst verloren. Uns froren die Gesichter ein. Claudia, die dreizehnjährige Nachbarstochter, zupfte verlegen an ihrer Bluse. Wir waren damals lange nicht so versaut wie die heutigen Heranwachsenden, aber was eine Hure ist, das wussten wir schon. Meine Mutter, der das blanke Entsetzen anzusehen war, brachte trotzdem nicht mehr als ein zart ermahnendes „Oskar!“ heraus.
Am späteren Abend, ich lag schon im Bett, hörte ich meine Mutter in der Küche weinen. Im Pyjama ging ich zu ihr. Sie saß am Tisch, ein Glas Rotwein vor sich. Die Tränen rannen ihr über die Wangen und hatten die Wimperntusche verschmiert. Aus dem Wohnzimmer drangen wieder die Klänge von Rare Earth – „Tobacco Road“, „Born To Wander“, „Hey, Big Brother“. Mein Vater gab sich die volle Dröhnung, in jeder Hinsicht, und gleich würde ich davon Kenntnis erlangen. „Was hast du denn, Mama?“, fragte ich sie besorgt. „Es ist wegen Papa“, sagte sie und nahm einen Schluck. „Aber geh jetzt wieder ins Bett.“ Ich überhörte ihre Aufforderung: „Was macht Papa immer so lang im Wohnzimmer bei der lauten Musik? Warum schläft er nicht?“ Mutter sah mich ein paar Sekunden mit leerem Blick an, hielt sich darauf die Hände vors Gesicht und wurde schließlich von einem herzzerreißenden Weinkrampf geschüttelt. Ohne dass sie es merkte stand ich auf und bewegte mich auf leisen Sohlen zum Wohnzimmer. Die Tür war versperrt. Ich klopfte. Es tat sich nichts. Deshalb klopfte ich noch einmal, diesmal kräftiger, und somit nahm das Drama seinen Lauf.

Denn jetzt vernahm ich im Wohnzimmer die Schritte meines Vaters und hinter mir die Schritte meiner Mutter. Mein Vater sperrte die Tür auf und öffnete sie. „Pauli!“, rief er erschrocken. Mit mir hatte er nicht gerechnet. Er hielt einen zusammengerollten Geldschein in der Hand. Rund um seine Nasenlöcher klebte das kolumbianische Marschierpulver. Ich war ziemlich verstört. „Papa, was ist das Weiße auf deiner Nase?“, fragte ich. „Sag’s ihm doch, sag’s!“, schrie meine Mutter, die schon neben mir stand. Ich bekam es mit der Angst zu tun und befürchtete, hier könnte was eskalieren. Mir zitterten die Knie. So hatte ich Mutter noch nie erlebt, ihre Verzweiflung musste ein hohes Ausmaß erreicht haben. Vater schüttelte nur wortlos den Kopf und wollte die Tür wieder schließen. Mutter ging aber mit dem Fuß dazwischen und drückte ihr ganzes Gewicht dagegen. Mein Vater wich zur Seite und sie stürmte zu dem großen rechteckigen Glastisch, der bei der Couch stand. „Sag deinem Sohn jetzt, was du hier machst!“, schrie sie wieder. Mit dem Zeigefinger deutete sie auf einen beachtlichen Haufen weißen Pulvers, der es in seiner Größenordnung zwar nicht mit dem Kokaingebirge aufnehmen konnte, das Al Pacino alias „Tony Montana“ in dem Gangster-Klassiker „Scarface“ vor sich auf dem Schreibtisch liegen hatte, bei dem ein durchschnittlicher Kokser aber bestimmt mit seiner Zunge geschnalzt und Respekt gebietend „Mein lieber Schwan!“ geäußert hätte. Vater stand wie angewurzelt an meiner Seite. Ich machte ein paar Schritte ins Zimmer und sah neben dem weißen Pulver Vaters silberne Diners Club-Karte. Darauf konnte ich mir überhaupt keinen Reim machen. „Dein Vater ist ein armer kranker Mann, er braucht das Zeug! Kokain, Rauschgift! Er zieht es sich durch die Nase rein, Tag und Nacht, deshalb ist er da so weiß!“, schrie sie wie von Sinnen. Sie fegte das Koks mit ihrer Hand vom Tisch und fiel weinend auf die Knie. Vater ging nun langsam auf sie zu. Er stand vor ihr, ließ den zusammengerollten Geldschein fallen, setzte sich neben sie und streichelte über ihren Kopf. Und dann heulte auch er. Es war ein beklemmender, jammervoller, furchtbarer Anblick – meine Eltern vor mir auf dem Boden, weinend wie zwei kleine Kinder. Die Musik war zu Ende, man hörte nur ihr Schluchzen und das angestrengte Atemholen dazwischen. Es war der Moment in meinem Leben, in dem mir klar wurde, dass ich auf mich allein gestellt war, dass ich Eltern hatte, die mich vor nichts und niemandem beschützen konnten, weil sie selbst die erbarmungswürdigen Kreaturen waren, die ich von nun an kannte.
Insgeheim hatte ich gehofft, der schreckliche Abend könnte die Wirkung eines reinigenden Gewitters haben und meinen Vater zur Umkehr in ein normales Leben bewegen. Aber diese Hoffnung war naiv, es wurde – im Gegenteil – alles nur noch schlimmer. Wenige Wochen nach meinem Geburtstag, mitten in den Sommerferien, sagten mir meine Eltern, ich müsse für ein paar Tage zu meiner Oma ziehen. Sie bräuchten einmal, erklärten sie mir, Zeit für sich allein – „Nicht bös sein, Pauli, gell.“ –, und sie würden gern ans Meer nach Holland fahren. Ich hatte nichts dagegen, bei der Oma zu sein, der Mutter meiner Mutter. Sie wohnte im sechsten Bezirk in der Joanelligasse, schräg gegenüber vom „Cafe Einhorn“, das dem legendären Jazzmusiker und Wiener Original Uzzi Förster gehörte. Die Oma trank jeden Tag ganz gechillt einen Doppelliter Rotwein der Billigmarke „Musketier“ und ließ mich mein Ding machen. Ich durfte bei ihr lesen und fernsehen so lange ich wollte und alles durcheinander essen, bis mir schlecht wurde (zum Beispiel eine Packung Mignon-Schnitten als Vorspeise, Gabelbissen mit Ei und Russen und zwei oder drei Mignon-Schnitten als Hauptspeise und als Nachspeise in Heidelbeerjoghurt getunkte Mignon-Schnitten). Gekocht hat die Oma eigentlich nie was, dafür war sie immer zu betrunken, und sie selbst hab ich eigentlich immer nur Haferschleim essen sehen. Sie war eine seltsam unnahbare Großmutter mit einer großen roten Säufernase, einem richtigen Pfrnak, wie sie selbst zu sagen pflegte und wie man in Wien früher große Nasen gemeinhin nannte und was im Tschechischen seinen Ursprung hat. Mit Opa hatte sie in den 50er und 60er Jahren ein florierendes Obst- und Gemüsegeschäft im vierten Bezirk in der Lambrechtgasse betrieben – bis sie durch den Wink einer Stammkundin draufkam, dass Opa, wenn er allein dort war, nach Geschäftsschluss seinen blauen Obst-und-Gemüsemann-Mantel abstreifte und zwischen den Bananenkisten und Erdäpfelsäcken eine Nutte nach der anderen bestieg, die er allesamt auf den einschlägigen Seiten im „Express“ ausfindig machte und telefonisch zu sich bestellte. Die Oma wollte das Geschäft, das sie so sehr geliebt hatte und in dem sich nun aber leider solche unzüchtigen und ehebrecherischen Schweinereien abgespielt hatten, nie wieder betreten. Sie ließ sich sofort scheiden und wollte keinen Mann mehr und wurde Hausbesorgerin in der Joanelligasse und fing bald mit dem Trinken an und trug nur noch an den Knien und am Hintern ausgebeulte Trainingsanzüge aus dem „Quelle“-Katalog. Trotz alledem sagte sie – wie dies unerklärlicherweise so viele Menschen tun, die im Leben die Arschlochkarte gezogen haben – den ganzen lieben langen Tag: „Ah, mia föhd nix, mia gähts jo so guad.“
Es blieb nicht bei einem Mal in der Joanelligasse. In den folgenden fünf Jahren übersiedelte ich in unregelmäßigen Abständen immer wieder zur Oma. Für Eltern sei es eben ganz wichtig, erklärten sie mir, ab und zu ohne Kinder zu verreisen. In Holland hätten sie ihr Paradies gefunden. Und die Meeresluft dort oben, wie gut die ihnen bekomme! Das reinste Märchen. Sie waren als Drogenkuriere nach Amsterdam unterwegs. Viele Jahre später legte meine Mutter mir gegenüber ein Geständnis ab. Kurz nach meinem denkwürdigen zwölften Geburtstag habe sie ebenfalls zu koksen begonnen. Sie habe, sagte sie, nicht mehr gewusst, wie sie anders an Papas Seite hätte weiterleben können, und ein Leben ohne ihn sei für sie schlicht und einfach unvorstellbar gewesen. Er habe sie dann auch von der Notwendigkeit überzeugt, für seinen Dealer, bei dem er schwer in der Kreide stand, das Kokain nach Wien zu bringen, mit ihr als Partnerin. Man könne dann ja auch selbst dealen und noch mehr Geld machen, ein Vorhaben, das sie bald verwirklicht hätten. In seinem Job als Werbetexter hätte Papa keine Chance mehr gehabt. An Aufträge, geschweige denn an eine feste Anstellung sei nicht mehr zu denken gewesen.
Geld war dank des Kokains jedenfalls im Überfluss da. Meine Eltern kamen daher wie die Filmstars. Im gemeinsamen Kleiderschrank reihten sich Marken wie Armani, Prada, Chanel, Valentino oder Yves Saint-Laurent aneinander. Mir kauften sie Lacoste-T-Shirts in allen Farben, die teuerste Tennisausrüstung und eine Märklin-Eisenbahn mit Seenlandschaft, Viadukten, Lawinenverbauung, Figurengruppen und Weichenstellanlagen für 15 000 Schilling! Papa bekomme so „irrsinnig viel Geld vom Arbeitsamt“, da er als Werbetexter ja ein Großverdiener gewesen sei, bekam ich damals von Mutter als Erklärung zu hören. Ich glaubte ihr das sogar, irgendwie. Und Oma trank ihren roten „Musketier“ und kaufte mir Mignon-Schnitten und Gabelbissen mit Ei und Russen und sagte „Ah, mia föhd nix, mir gähds jo so guad“ und stellte erst gar keine Fragen.
Das Leben an sich war mit meinen Eltern die Hölle. Schlimm genug, wenn du einen koksenden Vater hast. Schnupft auch die Mutter, wird’s ganz arg. Ab acht Uhr abends schlossen sich nun beide im Wohnzimmer ein. Da meine Mutter nicht so auf Rare Earth stand, dröhnte jetzt auch die Musik von ABBA und Kim Wilde durch die Wände. Aber „The Winner Takes It All“ oder „You Keep Me Hangin‘ On“ war nicht alles, was aus dem Wohnzimmer zu mir drang. Eines Nachts hörte ich meine Mutter fürchterlich schreien. Ihre Schreie klangen wie die Schmerzensschreie aus den Horrorfilmen, die ich mir in der Joanelligasse ansah. Mich ergriff eine nie dagewesene Angst, denn ich dachte, mein Vater würde ihr schreckliche Gewalt antun und sie am Ende töten. Ich sprang aus meinem Bett, lief zum Wohnzimmer und wollte schon gegen die Tür hämmern. Aber da hörte ich meine Mutter flehentlich insistieren: „Hör nicht auf, hör nicht auf!“ Was sollte das nun? Daraufhin sprach Vater: „Ja, du geile Drecksau, du, ich fick dich durch, dass dir Hören und Sehen vergeht, du Schlampe du!“ Dann wieder Mutter: „Ja, ich bin eine Drecksau und eine Schlampe, aber nur deine Schlampe!“ Vater: „Nein, nicht nur meine. Weil morgen fickt dich der Leo.“ – „Nein, aah, aah, nein!“ – „Doch, morgen wirst du vom Leo gefickt!“ – „Nein, nein, aahh!“ – „Halt’s Maul, du geile Sau! Sag, dass du morgen vom Leo gefickt werden willst!“ – „Ja, ich will morgen vom Leo gefickt werden, ja, Leo, fick mich, aah!“ – „Und ich schau zu.“ – „Ja, du darfst nur zuschauen, wenn der Leo in mir ist mit seinem geilen Schwanz.“ Mutter stieß wieder einen Schrei aus und überließ Vater das Wort: „Und übermorgen schaust du zu, wenn ich die Michi fickt, du dreckiges Luder.“ Worauf sie beide gleichzeitig schrien wie Viecher auf der Schlachtbank. Und dann war Ruhe. Das Koks hatte sie rasend geil gemacht und zu ergiebigem Dirty Talk animiert, aber davon hatte ich damals noch nicht die geringste Ahnung. Ich lief zurück ins Bett und konnte die ganze Nacht kein Auge mehr zumachen. Mehrmals sprach ich den befremdlichen elterlichen Dialog, der mir nie wieder aus dem Kopf gehen sollte, im Geist nach. Am Ende blieben nur ganz viele Fragen: Warum bezeichnete Mutter sich selbst als Drecksau? Wer waren Leo und Michi? Und wo sollte dieser Leo einen Schwanz haben? Der Hund von der Claudia hat einen Schwanz. Und warum sollte meine Mutter irgendwo einen Schwanz drinnen haben wollen? Am nächsten Tag kam Leo, und am übernächsten Michi.
Kapitel 4
Leo sah ziemlich gut aus. Ende dreißig, groß, breite Schultern, dunkelblonde, seitlich gescheitelte Mähne, volle Lippen. Wie der jüngere und viel schönere Bruder von Klaus Kinski. Fesch angezogen war er auch: Sakko, weißes Hemd, Jeans, Maßschuhe aus Pferdeleder. Obendrein fand ich ihn nett, er begrüßte mich mit „Servas, Buarli!“ und wuschelte mir dabei durch die Haare. Meinem Vater gab er die Hand, drückte ihn an seine Brust: „Servas, Oida!“ Mutter, aufgebrezelt in Stöckelschuhen, kurzem Rock und einer Bluse mit tiefem Ausschnitt, hielt sich an seinen Schultern fest, stellte sich auf ihre Zehenspitzen und küsste ihn auf die Wangen: „Babsi, supa schaust aus!“ Dann rieb er sich zufrieden und gutgelaunt die Hände: „Ah, schee woam hobzas do, koid is heit draußn, puh!“ Ich fragte mich, warum ich diesen Mann nicht kannte, wenn meine Eltern doch allem Anschein nach so vertraut mit ihm waren. Die Antwort lautete: Weil er der Kokaindealer meines Vaters war.
Das Abendessen, bei dem ich noch dabei sein durfte, wartete schon: Fritattensuppe und Rindsschnitzel in Saft mit Spiralnudeln. Leo aß nicht, er fraß. Den Löffel mit der Faust umklammert, saß er tief über den Teller gebeugt und schlürfte. Bei der Hauptspeise rann ihm der Saft übers Kinn, die Nudeln hingen aus den Mundwinkeln. Ich musste mir das Lachen verkneifen, so hatte ich bisher nur meine Lieblinge Bud Spencer und Terence Hill in „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Die linke und die rechte Hand des Teufels“ fressen sehen, Speck mit Bohnen gab es da immer in irgendeiner verkommenen Schnapsbude des Wilden Westens, bevor ein paar grenzdebile Halunken ausgiebig aufs Maul bekamen. Leos Art der Nahrungsaufnahme stand in krassem Widerspruch zu seinem dandyhaften Habitus. Hätte ich damals schon gewusst, dass er wegen zigfachen Autodiebstahls mehrere Jahre im Gefängnis verbracht hatte, es wäre für mich vielleicht nicht weiter verwunderlich gewesen. Aber wie konnte es sein, dass meine Mutter gestern an so einem Ferkel sexuelles Interesse bekundet hatte?
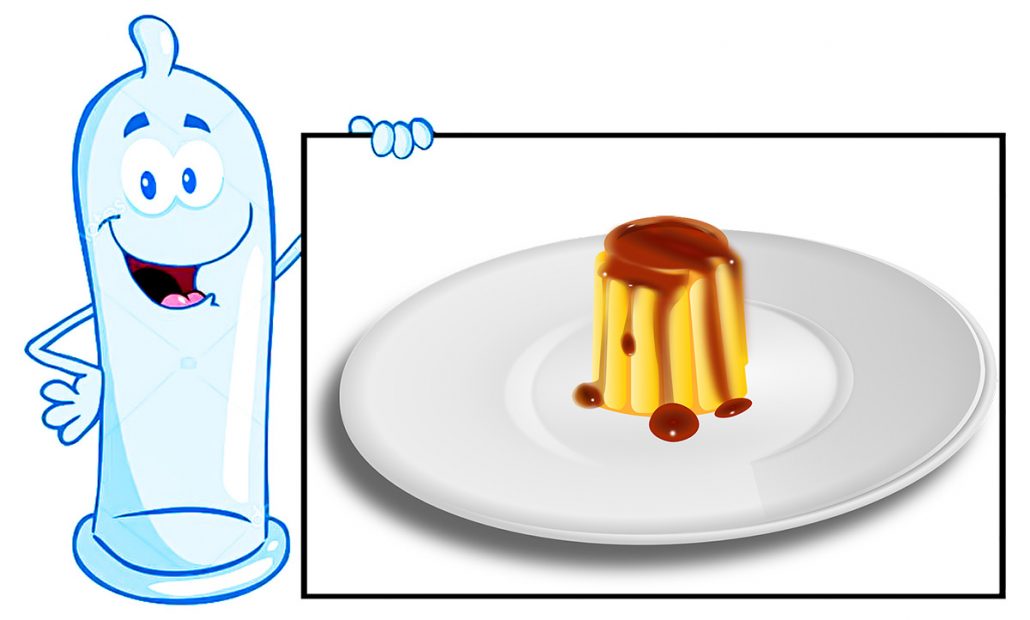
Nach dem Vanillepudding mit der Himbeersoße musste ich ins Bett. Jedoch schwor ich mir, auf gar keinen Fall einzuschlafen. Mit meinem Buch – „Die Rache der Komantschen“ – und der Taschenlampe lag ich unter der Decke und hielt die Ohren gespitzt. Bald war aus dem Wohnzimmer Musik zu hören, und die Stimmen der drei schwollen allmählich an. Meine Mutter lachte ungewöhnlich laut und oft. So vergingen zwei Stunden, in denen mir die Augen schwerer und schwerer wurden. Aber dann hörte ich Mutter in ihren High Heels auf mein Zimmer zustaksen. Ich machte die Taschenlampe geschwind aus und stellte mich schlafend. Sie öffnete die Tür, steckte nur ihren Kopf herein und ging wieder zurück zu den Männern. Offensichtlich wollte sie sich vergewissern, dass ich schon schlafe – was sie sonst nie tat. Mit einem Mal war ich hellwach, und wahrlich, es lohnte sich!
Sie stellten die Musik ab. Ich hörte ihre Schritte im Vorzimmer und dann eine Tür zugehen. Die wuchtige Eingangstür konnte es nicht gewesen sein; ich hörte ja auch keine Abschiedsworte. Die Tür zum Klo ebensowenig. Was hätten sie dort zu dritt machen sollen? Auch das Badezimmer kam nicht infrage. Es konnte also nur die Tür gewesen sein, die ins Schlafzimmer führte. Ich wartete zehn Minuten. Dann kroch ich aus dem Bett, schlich mich hinaus und hielt mein Ohr an die Pforte der Sünde. Mir stockte der Atem. Ich hörte meine Mutter und den schweinisch fressenden Leo stöhnen. Wie mein Vater stöhnte, wusste ich ja seit der gestrigen Vorstellung meiner Eltern, es war also hundertprozentig der Leo, und es war ein sattes, gleichmäßiges Stöhnen, etwa alle fünf Sekunden ein langgezogenes „Ooooh!“. Ich versuchte eins und eins zusammenzuzählen und sagte mir: Jetzt hat der Leo also seinen Schwanz in meiner Mutter. Was machte währenddessen mein Vater? Von dem hörte ich gar nichts. Moment, sagte Mutter gestern nicht, er dürfe nur zuschauen, wenn der Leo in ihr sei? Dann klatschende Geräusche, wie kräftige Ohrfeigen, und Mutter unterbrach ihr Gestöhne: „Ja, Baby, schlag mich!“ Baby? Schlag mich? War meine Mutter, Barbara Faber, gar eine Geisteskranke? Sollten wir sie nach Steinhof einliefern lassen, um sie vor sich selbst zu schützen? „Jo, du Luada, aufn Oasch brauchstdas, gö!“, kam es bösartig aus Leo hervor. Klatsch! Klatsch! Klatsch! Ich war total perplex, verstand die Welt nicht mehr. Konnte mein Vater wirklich dabei zusehen, wie seine Frau von einem anderen geschlagen wurde, selbst wenn sie das anscheinend freiwillig über sich ergehen ließ? Doch aufgepasst, jetzt hörte ich auch meinen Erzeuger: „Mm! Mmm! Mmmm!“ Jedes Mal ein bisschen mehr in die Länge gezogen, auf wohlklingend tiefer Frequenz. Was immer er da machte, es musste ihn mit Wonne erfüllen. Durfte er doch mehr als nur zuschauen? Mutter und Leo stöhnten wie gehabt. Je länger das dauerte da drinnen, desto mehr schien Vater sich geräuschmäßig dem Level der beiden anzunähern. Es endete in einem ohrenbetäubenden, zeitgleich einsetzenden Gebrüll der Männer und einem wenige Sekunden darauf erfolgten kurzen Aufschrei meiner Mutter, der von einem für mich unbegreiflichen und langanhaltenden Gewimmer abgelöst wurde, einem Wehklagen, als würde sie seit Tagen mit einer eiternden Schusswunde darniederliegen. Erst viele Jahre später, als ich mir schon einige Pornos reingezogen hatte – Cuckolding, Doublepenetration, Amateur Threesome Mmf usw. –, bekam ich eine Ahnung davon, was an jenem Abend im elterlichen Schlafzimmer vor sich gegangen sein könnte.
Am nächsten Morgen stand meine Mutter im Schlafrock in der Küche und machte mir meine Schuljause. Ich sah zwei dunkelviolette Flecken an ihrem Hals. „Was hast du da am Hals?“, fragte ich. Sie schien überrascht und ging ins Badezimmer. Von dort ging sie ins Schlafzimmer. Und zurück kam sie mit einem Tuch, das den Hals bedeckte. „Irgendeine allergische Reaktion“, sagte sie, „nichts Schlimmes. Geh jetzt, sonst versäumst du den Bus, du bist spät dran.“
Am Abend war der nächste flotte Dreier angesagt, diesmal aber Ffm. Michi kam zu uns, eine junge ehemalige Arbeitskollegin meines Vaters aus der Werbeagentur, höchstens Mitte zwanzig, ich kannte sie bisher nur vom Hörensagen. Die Kleine war scharf wie roter Chilli aus Mexiko. Sie hatte einen Traumhintern. Ihr Pagenkopf endete exakt auf Kinnhöhe. Unter dem hautengen Rollkragenpulli zeichnete sich der BH ab. Es war schon nach neun. Ein Essen, wie gestern mit dem jüngeren Bruder von Klaus Kinksi, stand nicht auf dem Programm. Ich wollte gerade ins Bett gehen. Michi gab mir noch die Hand und sagte, sie habe schon so viel von mir gehört, was für tolle Aufsätze ich schreiben würde! Und ein hübscher Bengel sei ich obendrein, da würden die Mädels bald Schlange stehen. Okay, dachte ich, kannst du bitte die Erste in dieser Schlange sein. Mich fraß der Neid, dass meine zugekoksten Eltern gleich herfallen würden über diesen heißen Feger. Aber keine Sorge, ich komme auch auf meine Kosten, trinkt erst noch ein paar Flaschen Wein, hört Musik, seid ausgelassen, lacht, ja, lach auch du wieder oft und laut, liebe Mutter!, komm dann gern wieder zu mir, steck dein schönes Brigitte-Bardot-Gesichtchen durch den Türspalt, ich werde die Taschenlampe freilich schon abgeschaltet und „Die Rache der Komantschen“ zuklappt haben, dann warte ich noch ein Weilchen, dann schleiche ich mich an, so leise wie ein Mörder in „Aktenzeichen XY…Ungelöst“, und dann stehe ich erneut vor eurer Tür und freue mich auf Sodom und Gomorrha. Und genau so geschah es. Alles sprach dafür – später erworbene pornografische Bildung wiederum vorausgesetzt –, dass Herr Faber zu Beginn meines Lauschangriffs seine Ex-Kollegin Doggy Style nahm. Sein Unterleib hämmerte wohl hart gegen ihr Hinterteil. Michi ihrerseits dürfte währenddessen die Muschi meiner Mutter verwöhnt haben, denn meine Erziehungsberechtigte hörte ich sagen (wenn sie ihr Stöhnen unterbrach), wie gut sie das mache. Sie trieben es etwa eine Stunde und vermutlich in allen Variationen. Die vom Rauschgift befeuerte Entladung meines Vaters und die Laute der Frauen klangen für einen noch nicht Dreizehnjährigen ziemlich entmenscht.
Michi hatte bei uns übernachtet. Es gab ein Frühstück zu viert, schon um sieben Uhr morgens. Sie musste wegen der Vorbereitung einer Präsentation zeitig in der Agentur sein. Mein Vater sah fertig aus. Er saß mit hängenden Schultern da, aß keinen Bissen, trank nur schwarzen Kaffee aus seiner Tasse mit der Aufschrift „HAVE A NICE DAY“. Die zwei Damen hingegen sprühten geradezu vor Energie, als hätten sie noch schnell zwei fette Linien vom Nachtkästchen geschnupft. Michi fragte mich, ob ich gut geschlafen hätte und die Musik eh nicht zu laut gewesen sei, sie habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Mutter antwortete für mich: Um den Pauli müsse man sich in der Nacht keine Sorgen machen, der schlafe wie ein Bär in seiner Winterhöhle, neben dem, meinte sie tatsächlich, könnte sogar eine Atombombe explodieren. Ich war plötzlich von der Idee besessen, sie alle drei zu schockieren. Sie sollten nicht denken, ich sei so ahnungslos, wie sie glaubten. Ich stellte der Runde eine längere Frage: „Was heißt das eigentlich, wenn eine Frau sagt, dass ein Mann in ihrem Mund kommen soll? Grammatikalisch richtig müsste es ja heißen: Der Mann soll in ihreN Mund kommen, nicht ihreM. Aber wie soll ein Mann in den Mund einer Frau kommen, das geht sich doch von der Größe nie und nimmer aus. Kann mir das bitte einmal jemand erklären?“ Jetzt biss ich herzhaft in meine Salamisemmel. Totenstille. Mein kaputter Vater starrte entsetzt seine Kaffeetasse mit der Aufschrift „HAVE A NICE DAY“ an. Mutter errötete bis in ihre Ohrmuscheln. Michi aber fing plötzlich zu kreischen an und schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte: „Ich halt’s nicht aus! Ist das herrlich! Ich pack’s nicht! Der Pauli, nein, der ist doch der Allergrößte!“ Als meine Mutter sich halbwegs erfangen hatte, meinte sie nur: „Zieh dich jetzt bitte an und geh in die Schule.“ Sie wagte es nicht, mir in die Augen zu schauen.
Michi sah ich trotzdem nie wieder. Leo schon. Threesome-Action mit dem Ex-Häfenbruder stand noch eine Zeit lang hoch im Kurs. Zum letzten Mal kam er aber in anderer Absicht, und ich hatte Angst um das Leben meines Vaters.
Es war in der Woche vor Weihnachten, mitten in der Nacht, vor unserem Wohnhaus in der Döblinger Hauptstraße tanzten die Schneeflocken. Ich wurde vom Läuten der Sprechanlage geweckt. Wer konnte das sein um diese Uhrzeit? Ich bekam Herzklopfen. In der Wohnung blieb es mucksmäuschenstill. Hatten meine Eltern es nicht gehört? Es läutete wieder, drei Mal kurz hintereinander und ganz lang. Immer noch ging keiner zu dem Sprechapparat, der an Wand neben der Eingangstür hing. Ich spürte meinen Puls bis in die Halsschlagader. Da ich es nun nicht mehr aushielt in meinem Bett, machte ich mich auf den Weg ins Schlafzimmer. Ich öffnete die Tür. Es war finster. Nur von der Straßenbeleuchtung schien Licht herein. Mein Vater stand in Unterhose und mit einer Zigarette in der Hand am Bettrand. Meine Mutter, im Pyjama, wollte gerade zum Fenster gehen. „Nicht, ich hab ihn doch schon gesehen!“, herrschte Vater sie an. Sie drehte sich um und erschrak: „Pauli, was machst du denn da? Geh wieder schlafen.“ – „Ich kann nicht schlafen, ich hab Angst, wer ist das?“ – „Der Leo.“ – „Was will er denn?“ – „Er will ein Geld. Er sagt, wir schulden ihm was. Aber das stimmt nicht, er spinnt.“ Es läutete inzwischen Sturm. Ich legte mich einfach ins Bett der Eltern. Keine zehn Ochsen hätten mich da wieder rausgebracht, meine sogenannten Erziehungsberechtigten schon gar nicht, die waren viel zu angespannt, um sich weiter mit mir beschäftigen zu können.
Das Läuten hörte für ein paar Minuten auf. Trügerische Stille. Vater ging ans Fenster, schob die Gardine ganz vorsichtig zur Seite und warf einen Blick auf den Gehsteig: „Ich glaube, er ist weg.“ Das glaubte er aber nur. Denn plötzlich hörten wir Fäuste wie wild gegen die Eingangstür schlagen! Irgendein Idiot musste ihn ins Stiegenhaus gelassen haben. Mutter kaute hochgradig nervös an ihren Fingernägeln: „Um Gottes Willen, die Nachbarn!“ Vater ging langsam ins Vorzimmer, machte dort das Licht an und stellte sich vor die verschlossene Tür. Ich eilte ihm nach und flehte ihn an, nur ja nicht aufzumachen. Hinter mir meine Mutter. Er klopfte mir beruhigend auf die Schulter und rief: „Schleich di, sunst ruaf i die Polizei, host mi vaschdaundn!“ – „Moch auf, moch auf, du Oaschloch! Sunst bring i di um, i schwöa das, i hob die Krochn mit! Do schau her!“ Vater blickte durch den Spion und schüttelte fassungslos den Kopf: „Der hat eine Pistole in der Hand.“ Ich war vor Angst wie gelähmt. Und mir klapperten die Zähne. Mutter, von Panik ergriffen, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Dann schrie sie: „Der ist total irre, der hat mindestens drei Gramm Koks im Blut, wir müssen sofort die Polizei rufen!“ Leo verpasste der Tür mehrere Fußtritte. Mein Vater ging die paar Schritte zum Telefon, wählte den Notruf der Polizei und sagte in erstaunlich ruhigem Tonfall: „Grüß Gott. Wir, meine Frau, mein Sohn und ich, werden von einem Mann mit Pistole bedroht. Er steht vor unserer Tür. Können Sie bitte schnell einen Wagen schicken.“ Er nannte noch Name und Adresse, legte auf, kam wieder zur Tür und rief dem wahnsinnigen Leo zu: „So, Gestörter, die Polizei is glei do!“ – „Des kaunst deina hinnichen Mutta dazöhn!“ Er meinte damit wohl meine schon vor längerer Zeit verstorbene Großmutter väterlicherseits und fuhr nach kurzer Pause fort: „Und wenn – glaubst, i scheiß mi au vua a poa deppate Kiwara!“ Meiner Mutter schien plötzlich was eingefallen zu sein. Sie lief ins Wohnzimmer, kam von dort schnell wieder hinaus und steuerte das Klo an. Dort blieb sie bei halb geöffneter Tür nur wenige Sekunden. Man hörte die Spülung, sie kam wieder zu uns und flüsterte meinem Vater was ins Ohr. Worauf der nickte und erleichtert ausatmete. Im Stiegenhaus war es sonst ruhig. Von wegen Nachbarn, die sich über den Lärm beschweren könnten. Aber ehrlich, wer will sich in Döbling schon mit einem Bewaffneten anlegen? In Favoriten, Ottakring oder Rudolfsheim-Fünfhaus sähe das vielleicht anders aus. Noch ein heftiger Fußtritt gegen die Tür – aber dann kam er doch halbwegs zur Vernunft und zog Leine, der Leo. Wir sahen ihn die Döblinger Hauptstraße in Richtung Hohe Warte davonlaufen.
Die Polizei war erst zehn Minuten später da. Als sie meinen Vater fragten, ob er den Mann kannte, sagte er ohne mit der Wimper zu zucken Nein. Und bei der Personenbeschreibung machte er absichtlich falsche Angaben. Er schien sich gedacht zu haben, da die unmittelbare Gefahr vorbei war, den Leo lieber nicht auszuliefern. Wer weiß, ob man dann nicht selbst in höchste Bedrängnis geraten würde. Die Polizisten kratzten sich aber während der Befragung ganz schön am Kopf, denn es war ihnen schlicht ein Rätsel, was ein Wildfremder um halb zwei in der Nacht mit einer Pistole vor einer x-beliebigen Wohnungstür in Döbling zu suchen hatte. Meine Mutter klärte mich über den wahren Hintergrund des bewaffneten nächtlichen Überfalls im Zuge ihrer Jahre später erfolgten Kokainbeichte auf. Dieser Leo sei davon überzeugt gewesen, Vater habe große Mengen des aus Amsterdam herbeigeschafften weißen Pulvers für sich abgezweigt, was natürlich völliger Schwachsinn sei und nur einem vom Rauschgift schon aufgeweichten Gehirn entspringen konnte. Trotzdem sei dieser schreckliche Vorfall nicht das Ende der Zusammenarbeit mit Leo gewesen. Man habe ihn von der Unrichtigkeit seiner Annahme überzeugt und Frieden geschlossen. Wovon hätte man sonst leben und mich ernähren sollen? Was ich noch gern erfahren hätte von meiner Mutter: ob Papa oder Leo den Größeren hat. Ich stellte diese Frage nicht.
Fortsetzung folgt ….