AKUT
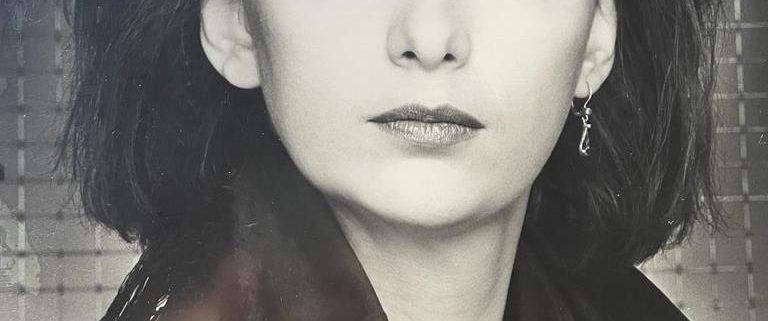
Andrea Fehringers 00er-Jahre
Du, Feh. So begannen fast alle Sätze, die damals jemand an mich richtete. Und sie gingen alle irgendwie gleich weiter.
Du, Feh, hast du schon …
Du, Feh, kannst du schnell …
Du, Feh, wir braucherten noch …
Der Erste, der sich mit diesen beiden Worten bei mir gemeldet hatte, war Peter Mosser gewesen, als er mich Anfang des neuen Jahrtausends anrief:
Du, Feh, ich brauchert dich …
Als mich gestern Franz Sauer anrief, sagte er haargenau dasselbe: Du, Feh, ich brauchert dich …
Text: Andrea Fehringer / Foto Header: Stefan Liewehr
Zwischen den beiden Anrufen liegen vierundzwanzig Jahre. Peter Mosser, mit dem ich schon länger bei der DIVA zusammengearbeitet hatte, war 2000 gerade Chefredakteur des neuen WIENER geworden und braucherte mich auch dort als Textchef. Ja. Textchef. Dass sich die männliche Form des Jobs noch nicht im Ohr zuspitzte und sich das heimatlos herumirrende in mit einem zum Pfeil geschärften i-Punkt voran ins feministische Herz bohrte, störte damals niemanden. Hey, Leute, wir waren jetzt ein Männermagazin.
An sich war mir die Sache nicht ganz neu. Ich war schon einmal Textchef des WIENER gewesen, sechs Jahre lang, als das Blatt noch ein General-Interest-Magazin gewesen war, also Lesestoff für alle. Weil aber alle eine Zielgruppe war, an die zu glauben man sich nach den fetten Jahrzehnten langsam doch abgewöhnte, bekam der WIENER mit dem Lifestyle-Zeitschriften-Verlag andere Besitzer und eine neue Unterzeile: Alles für ihn.
Dass dieses Alles ein Versprechen war, das auch nicht gehalten werden würde, hielte ich heute für überkommenen, männlichen Allmachtsanspruch. In Wahrheit war es eine Frage des Lifestyles, der nach dem Vormarsch internationaler Magazine für ihn am Zeitschriftenmarkt die Welt war. Und weil die Welt immer schon das Zuhause des Mannes war, öffnete sie sich praktisch von selbst als neuer natürlicher Aufenthaltsraum. Nach den Diktaten der sich ständig neu erfindenden Frau, die den Mann seit zwanzig Jahren verwirrten, bis er nicht mehr wusste, was er war, sein durfte oder sein sollte, war es Zeit, ihm die Stange zu halten. Für genau solche sprachlichen Unfeinheiten war ich jetzt da. Aus heutiger Sicht war ich die Frau fürs Grobe. Für das, was wir damals aus der Feder fließen ließen, würden wir heute geteert werden.

Meine Aufgabe war es, sämtliches redaktionell Geschriebene, das zwischen den Anzeigen ins Blatt kam, zu bearbeiten. In einer heilen Welt der Textchefs, sofern sich ein Heft heute so einen Luxus überhaupt noch leistet, bedeutet diese Arbeit, sich mit Titeln, Vorspännen, Bildtexten und Zitaten, die sogenannte Ausstattung der Geschichten zu überlegen und im Lauftext mal hier, mal da einen fehlenden Beistrich hinzutippen.
Die Welt des WIENER war fast so heil. Peter Mosser hatte ein verdammt gutes Team zusammengestellt. Erich Reismann mit seinem fotografischen Blick für das Innenleben der Menschen; Michel Reimon, heute grüner Politiker, damals Autor und ein Chef vom Dienst, der immer, wenn mir kein Titel zu einer Story einfiel, hinter mir stand und mir einen ins Ohr flüsterte; Herbert Winkler, der als Art-Director mit Wallpaper-Lorbeeren dem Heft sein Aussehen gab; und stellvertretend für alle, die ich hier nicht aufzählen kann, Mitarbeiter wie Axel Halbhuber mit einem Gemüt, das noch nie einen schlechten Tage gesehen hatte. Vor allem mit Journalisten und Autoren wie Manfred Sax und Eberhard Lauth an meiner Seite war das Textniveau grandios.
Sax, der Konzeptionist, der der Redaktion die Kunst nahebrachte, jede noch so komplexe Metaebene einer Story in eine verkaufsträchtige Prämisse zu bündeln, um sie dann mit einem originell gesponnenen roten Faden in leichten Lesestoff zu verwandeln, den man überzieht wie ein Kleidungsstück, das wie Maßarbeit sitzt. Als er den WIENER Jahre später kurzfristig verließ, stieg die Mannschaft auf die Tische, so wie die Schüler, die ihren Lehrer Robin Williams im Club der toten Dichter verabschiedet hatten, Käpt’n, mein Käpt’n. Ich war nachher mit ihm beim Thailänder essen, es war eine schweigsame Mahlzeit.
Eberhard Lauth war der Seismograph der Unvollständigkeit, der Hüter der Logik in einer Geschichte, der die winzigsten Löcher in der Recherche aufstöberte, selbst wenn sie zwischen den Zeilen lagen. Ich habe ihm zu verdanken, dass ich nicht Gefahr laufe, irgendwann zu einer ewig gestrigen Schreiberin zu werden, weil Ältere von Jüngeren genauso viel lernen können wie Jüngere von Älteren. Ich glaube, ich war die, die mehr von uns hatte. Was er in seiner Art, im Gespräch mit einem Minimum von Worten auszukommen, bestreitet. Nein. Ich glaube, er hat sich auch nie zu einem Du, Feh verstiegen.
Ich steuerte schließlich das Buchstäbliche bei. Michel Reimon sagte mir einmal: »Du, Feh, ich kenne niemanden, der so in der Sprache an sich aufgeht, völlig ungeachtet eines Themas.« Ein Kompliment mit Unterlassungsvorwurf. Er hat recht, aber man ließ es mir durchgehen.

Meine Arbeit beim Männermagazin WIENER begann mit einer langen Nacht. Einer von vielen. Die erste Nummer entstand irgendwo zwischen Wien und Winchester. Hier die Redaktion, dort Manfred Sax, der von daheim arbeitete. Es war ein Pingpong, immer an der Kante des Spielfelds. Aber es klappte. Nichts war schiefgegangen. Abgesehen von dem Festnetztelefon, das der in den Hitzen sämtlicher Gefechte nahezu bis zur Leidenschaftslosigkeit beherrschte Peter Mosser im Zorn aus der Wand riss, auf seinen Schreibtisch knallte und brüllte: »Leckts mich doch alle am Arsch.«
Am Vormittag des nächsten Tages, ging ich aus der Redaktion, völlig übernächtigt nach zwei Tagen Durcharbeiten, aber mit dem Gefühl, etwas Unmögliches hingekriegt zu haben. Das Heft war in der Druckerei, als wir den Fehler bemerkten. Auf der Inhaltsseite, die ganz zuletzt getextet wurde und die Geschichten möglichst pointiert ankündigen sollte, stand bei einer Story: Blindtext, Feh bitte Hilfe. Blindtext, Feh bitte Hilfe. Blindtext, Feh bitte Hilfe. Blindtext, Feh bitte Hilfe. Zwei Zeilen lang, und niemandem von mir über vier weiter Kontrollstationen war es aufgefallen. Naja, wenig pointiert, aber originell.
Schon für die nächsten Schlussproduktionen reiste Manfred Sax aus Winchester an. Er wohnte ab da für acht, zehn Tage im Monat in meinem Haus. Es war eine Art Schreib-WG, und er der erste eines vorwiegend männlichen Freundeskreises, von denen meine Zwillingstöchter später sagten: »Mami, ganz ehrlich, du hast immer seltsame Freunde gehabt. Normal war in den Jahren unserer Schulzeit eigentlich nix.«
Wenn wir nicht über den Sinn des Lebens philosophierten, den Sax letztlich in drei Worten definierte, nämlich: nur net sterben, drehte sich alles ums Schreiben. Wobei Sax ein Autor mit einem ganz speziellen Zeitgefühl ist. Das, was man beim WIENER immer den Zeitgeist nannte, hatte er im kleinen Finger. Abgabetermine maß er nicht einmal über den Daumen. Irgendwann hatten wir ein Gefühl dafür, was er meinte, wenn er sagte: Hab gerade angefangen. Übersetzung: Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich noch eine Geschichte schreiben muss. Bin beim Durchlesen. Übersetzung: Mir ist noch immer kein Einstieg eingefallen. Schick euch gleich den Text. Übersetzung: Ich muss schnell was für die Kinder kochen. Sollte eigentlich schon bei euch sein. Übersetzung: Okay, ich hab jetzt den ersten Satz. Anfangs glaubten wir das alles noch, die kurzen Texte des Heftteils mit dem Titel akut, den er schrieb und verantwortete, kamen immerhin ratzfatz. Bei längeren Storys gaben wir ihm einen zeitigeren Redaktionsschluss, was die Sache allerdings nicht beschleunigte. Sax war in seinem Zeitmanagement ungefähr so akut wie ich trendy.
Ja, die Trends der Zeit waren nie das, was ich erriechen konnte. In Wahrheit interessieren sie mich bis heute nicht. Privat lebte ich so weit von ihnen entfernt, wie es beruflich nur zu verbergen war. Von mir wäre nie die Idee zum Metro-Mann gekommen, den Sax aus der Feder zauberte. Ich hatte kein Gespür für die Themen, die in der Luft lagen, aber in diesem Blatt immer ein Totschlagargument: Ich war eine Frau. Übrigens die einzig fixe im Team. Seltsamerweise schienen das alle immer wieder zu vergessen, inklusive mir. Auf die Art bekam ich einen Einblick in die Männerwelt, von dem ich irgendwann nicht mehr wusste, ob ich den überhaupt wollte. Ich erinnere mich an einen Aufruhr im Nebenzimmer, als irgendwer in der Grafik entdeckte, dass bei einem Internetsender die Nachrichten von einer barbusigen Ansagerin gelesen wurden. Meine Herren.
Ich saß mitten in ihren Männergesprächen. Wir waren zu viert im Zimmer, Peter Mosser, Michel Reimon, und links von mir mal der, mal ein anderer. War Manfred Sax im Zimmer, ging es um Sex. Wenn nicht, ging es um Sex. Und manchmal ging es auch um Sex.
Zum Teil war ich stolz darauf, dass sich vor mir niemand verstellte, und redete mir sogar ein, sie sähen mich als Ehrenmann. Zum Teil wurde es selbst mir hin und wieder zu viel. »Burschen«, sagte ich dann, »merkt ihr eigentlich, dass ich auch noch da bin?« Einen Augenblick sahen sie mich irritiert an, ich glaube nicht, dass sie meinen Hinweis auf mehr als meine Anwesenheit bezogen. Ja, eh, die Feh war da. Und? Das haben Institutionen so an sich.

Ja, offenbar war ich sowas wie eine Institution im WIENER, das höre ich heute noch, von denen, die dabei waren, und von denen, die sich erzählen ließen, wie es war, dabei gewesen zu sein. Ich war die gute Feh. Eine, die was kann und die man mag und die unbedingt dazugehörte. Eine Quotenfrau war nie das, wozu sie mich braucherten. Die, mit der man nicht nur Pferde, sondern Hengste stehlen konnte. Ein Wesen mit Körbchengröße, deren wahre Oberweite sich allerdings hinter der Stirn auftat. In männlicher Manier beschützte man mich, wozu es allerdings wenige Gelegenheiten gab. Außer vielleicht den 11. September 2001. Während die beiden Flugzeuge in die Twintowers flogen, fuhr ich in die Semmelweisklinik und betrauerte das Ende meiner zweiten Schwangerschaft, es wären wieder Zwillinge gewesen.
Es ist ein Knäuel an Erinnerungen, das sich da immer weiter vor mir abspult. Als ich mir nach Franz Sauers Anruf noch überlegte, welche davon ich schreiben kann und welche ich schreiben will, und ob ich es denn überhaupt irgendwem antun sollte, sich in meinem Gedächtnis umzutun, schlich sich ein völlig absurder Grund ein, der mich doch an den Schreibtisch lotste. Ich darf nämlich hier etwas, wofür ich allen anderen immer auf die Finger geklopft hatte. Ich kann einfach drauflosschreiben. »Es darf ruhig komplett persönlich sein«, hatte Franz gesagt. Selber schuld. Ich habe mir zwar einen Einstieg überlegt, aber Du, Feh, echt jetzt? Was ist das für ein erster Satz? Und schon beim Programmabsatz hätte ich mir als Textchefin die Geschichte um die Ohren gefetzt. Lass das Ich raus, wen interessiert das? Fang nie eine Geschichte in der Vergangenheit an, das macht sie gleich einmal alt. Aus Sätzen wie diesen war damals ein Schreibseminar entstanden, das WIENER-Geschäftsführer Gerhard Koller fast unaufgefordert als Verlags-Service deklarierte und ihm damit den Klaps auf den Hintern gab, dass es sich bis heute zu einer digitalen Schreibakademie entwickeln konnte. www.ichschreibe.at, wenn ich das so nebenbei einflechten darf. In dieser Story auf meine eigenen Regeln und Tipps zu pfeifen, macht mir gerade einen Riesenspaß. Tja, scheiß drauf.
Vielleicht ist es die kleine Rache für einen Mitarbeiter, der seine Texte immer mit dem furchterregenden Satz abgab: »Ich glaube, das ist das Beste, was ich je geschrieben habe.« Ich kam nie wirklich gegen diese Überzeugung an. Oder für die Monologe von Manfred Klimek, der zu uns ins Zimmer stürmte wie von der Bühnengasse, in Lautstärke und Tempo meinen gleichzeitig bellenden Hund übertönte, und nach exakt zwanzig Minuten wieder abging. Vielleicht ist es aber auch ein Geschenk an einen gewissen Franz Sauer, der trotz des Trios Sax-Lauth-Fehringer schreiberisch machte, was er wollte.
Ich weiß übrigens noch genau, wann dieser Sauer auftauchte. Es war eine Redaktionskonferenz, in der er sich beim Chefredakteur Mosser beliebt machte, indem er sich zu jeder Geschichte, die vorgeschlagen wurde, komplett unabhängig vom Thema, meldete und sagte: »Ich kenn da jemanden, mit dem wir reden sollten.« Nächste Story: »Ich weiß da einen, der ist ein echter Insider.« Nächste Story: »Ich hab da wen, der kennt sich wirklich aus.« In Sax und mir begann umgehend der Ehrgeiz zu lodern, diesen Typen mundtot zu machen. Von da an hatten die Geschichten, die wir ansagten, zusätzlich den Hintergrund, dass dem Sauer dazu nichts und niemand einfallen konnte. Irgendwann hatten unsere Geschichten nur noch diesen Hintergrund. Sauer ließ sich kein einziges Mal ausbremsen.
Ich habe viele glückliche Zeiten in meinem Beruf erlebt, ja, das Wort ist mir nicht zu groß. Die Nullerjahre stehen in der Liste ganz oben. Es gibt nur eines, was ich als Mitglied einer Männer-Redaktion gründlich falsch gemacht habe. Ich hätte verschweigen sollen, dass ich meinen Hund Xaver nun doch kastrieren würde.






